Chris de Burgh, Sie haben europäische Geschichte studiert, wie sehr verfolgen Sie aktuelle politische Entwicklungen?
Chris de Burgh: Mich interessiert das immer noch, ich lese viel die aktuellen Nachrichten. Es hat keinen großen Einfluss auf meinen Beruf, aber natürlich ist es wichtig zu wissen, was um dich herum passiert. Ich bin immer schockiert, wenn ich in den USA bin, wie wenig die Amerikaner wissen, was im Rest der Welt passiert. Besonders wenn man bedenkt, dass ihr Land quasi in alles in der Welt verwickelt ist.
Haben Sie den Eindruck, dass wir, hinsichtlich der Politik, aus der Geschichte gelernt haben?
de Burgh: Nein, das denke ich nicht. Wir beziehen uns allerdings ständig darauf, ziehen historische Vergleiche, beispielsweise werden Parallelen zwischen Putin und Hitler gezogen. Ich denke zwar, dass diese Parallele nicht korrekt ist, aber nichts desto trotz: Was Putin macht, ist so gefährlich wie nichts Anderes in der Welt, was in den letzten 50 Jahren passiert ist.
Wir müssen immer wieder zurückschauen und versuchen, Lehren aus der Geschichte zu ziehen und sie auf unser heutiges Leben anwenden. Ich denke, dass die UNO eine großartige Errungenschaft ist. Sie erscheint mir zwar oft ziemlich zahnlos, aber zumindest sind es vereinte Nationen, die versuchen, zu verhindern, dass bestimmte Dinge wieder passieren. Aber die Menschen werden sich immer wieder bekriegen.
Um mit Ihrem Albumtitel „Hands of Man“ zu sprechen – erschaffen diese Hände heutzutage mehr positive oder negative Dinge?
de Burgh: Ich denke, es gleicht sich aus. Wir können mit den Händen heilen, wir können aber auch Kriegsmaschinen bauen, die den Planeten in einer Sekunde vernichten können. Ich mag zum Beispiel Architektur, alte Gebäude, vor dem Kölner Dom zu stehen und zu bewundern, was die Ahnen getan haben. Andererseits, wenn man heute im Osten Berlins ist, kann man genau sehen, welche Bauten in der DDR-Zeit entstanden sind, weil die Plaste abfällt. Von der Berliner Mauer, glaubten die Russen ja wirklich, dass sie etwas erreichen würde – aber sie hat gar nichts erreicht. Kommunismus funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Und Kapitalismus?
de Burgh: Nein. Also, bis zu einem gewissen Grad funktioniert er. Er ist ein Motor und es ist gut zu wissen, dass wir für eine Leistung Geld erhalten. Doch das Geld ist ungleich verteilt, wenn Leute, die am Computer sitzen, Banker usw., Milliarden von Euros bewegen und dadurch ihren Reichtum generieren, der nicht ihren Fähigkeiten oder der Menge an Arbeit entspricht. Ein Straßenarbeiter verdient nichts im Vergleich, hat aber einen harten 10-Stunden-Arbeitstag. Das ist nicht ausgeglichen.
Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Melodien, die man erfinden kann.
Sie beziehen sich in ihren Texten immer wieder auf historische Figuren, auf „Hands of Man“ geht es um Richard Löwenherz. Es heißt, Sie wären mit ihm entfernt verwandt…
de Burgh: Das ist eine Legende, ob sie stimmt, weiß ich nicht.
Sie haben schon in den 70ern über Kreuzzüge gesungen, warum dieser Rückblick aufs Mittelalter?
de Burgh: Es fasziniert mich einfach, diese ganze Ära. Es kommen auch junge Leute zu meinen Konzerten, die diese historischen Geschichten mögen. Und nicht viele Songwriter schreiben diese Art von Songs. Wobei ich meine Texte praktisch über alles schreibe, was meine Aufmerksamkeit anzieht. Es geht nicht nur um Historie, es ist auch nicht alles „Lady in Red“ oder „Don’t Pay the Ferryman“.
Gibt es ein aktuelles politisches Thema, über das Sie singen würden?
de Burgh: Ja, auf „Hands of Man“ singe ich auch über das Recht der Frauen auf Bildung, Selbstbestimmung und Respekt – ohne dass der Mann ihnen sagt, was sie zu tun haben. Im Iran erhalten Frauen in manchen Gegenden keine Bildung, sondern sie sollen zuhause arbeiten und Kinder kriegen; dem Mädchen Malala aus Pakistan wurde ins Gesicht geschossen, weil sie sich für die schulische Bildung von Mädchen einsetzte – das ist abscheulich. In Saudi-Arabien braucht eine Frau die Erlaubnis des Mannes, um arbeiten gehen zu können. So etwas wurde von Männern entwickelt, um Frauen zu dominieren und zu kontrollieren. Sie berufen sich dabei auf alte Bücher – und wer hat die geschrieben? Männer.
Sie versuchten schon vor vielen Jahren, die Erlaubnis für ein Konzert im Iran zu bekommen…
de Burgh: Ja, ich würde dort immer noch sehr gerne auftreten. Wenn ich etwas über Iran auf meiner Facebook-Seite schreibe, zum Beispiel im März „Happy Nouruz“ (zum persischen Neujahrsfest), dann kommen innerhalb von 20 Minuten 20.000 Fans zusammen, die sich bedanken.
Wir waren damals auch schon im Iran, um uns Veranstaltungsorte anzusehen. Doch dann kam die Wahl von Ahmadinedschad, die Mullahs bekamen mehr Macht und im US-Wahlkampf sagte John McCain, man wolle den Iran bombardieren, während Obama den Iranern die Hände schütteln wollte. Ich denke, die Zeiten ändern sich, mein Management fragt jedenfalls immer wieder nach.
Wie Sie kommen auch Bono, Sinead O’Connor und Bob Geldof aus Irland, die sich für Frieden und soziale Zwecke einsetzen. Ist das Zufall, oder spielt dabei auch die irische Heimat eine Rolle?
de Burgh: Interessante Frage. Ich kenne Geldof und Bono sehr gut, aber ich weiß da keine Antwort. Die Iren sind glaube ich sehr offenherzig und großzügig, wenn es um Nöte außerhalb Irlands geht. Wobei wir das viel mehr zuhause bräuchten, es gibt viele Dinge in Irland, wo wir wirklich Engagement brauchen. Aber aus irgendeinem Grund fühlen sich die Leute besser, wenn sie hungernde Menschen in Afrika retten. Ich glaube da eher an das Sprichwort: Charity begins at home – Nächstenliebe beginnt zu hause.
Über Ihre Wohltätigkeitsarbeit weiß man nicht besonders viel.
de Burgh: Ich tue das eher im Stillen. Es ist ja auch so – das betrifft jetzt aber nicht Geldof und Bono – dass sich sich manche Leute mit Charity hervortun, aus Gründen, die mit der Wohltätigkeit nicht viel zu tun haben, sondern mehr mit der eigenen Profilierung. Und das ist mir unangenehm, da überschreitet man eine Linie, wenn man seine Bekanntheit einbringt damit am Ende wieder die eigene Bekanntheit und Karriere davon profitiert.
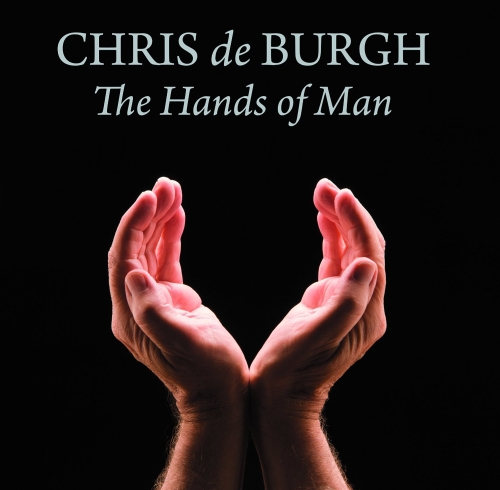 Sinead O’Connor sang 2012 die Zeile „I wanted to change the world, but I could not even change my underwear“.
Sinead O’Connor sang 2012 die Zeile „I wanted to change the world, but I could not even change my underwear“.
de Burgh: Haha (lacht)
Können Sie diese Hilflosigkeit nachvollziehen?
de Burgh: Also, das ist ja das, was ich glaube: Popstars können rein gar nichts verändern. Sie können Aufmerksamkeit generieren, aber von Politikern werden sie ignoriert, außer es gibt einen guten Foto-Termin. Politiker scheren sich kaum um das, was Popstars alles versuchen, davon bin ich überzeugt. Wir können Aufmerksamkeit erzielen und sagen „hier, hier, hier“. Aber Spitzenpolitiker wie Angela Merkel – die auf meine Konzerte kam, als sie jung war, ich habe auch vor drei Jahren eine Art privates Weihnachtskonzert für sie gegeben – diese Leute treffen Entscheidungen basierend auf sehr wichtigen politischen Gegebenheiten. Es ist ja okay, wenn Bono Obama die Hand schüttelt und sagt „Hey, Mr. Obama, könnten Sie dies, könnten Sie das…?“ Für Obama ist das dann ein schönes Foto, aber es verändert nichts. Es gibt bestimmte Leute an der Spitze und wenn die eine Entscheidung fällen, dann ist es so – und hat nichts mit uns zu tun.
Sie haben einmal im Jahr 2009 nach einer schlechten Konzertbesprechung einen Brief an den Rezensenten geschrieben, dem Sie u.a. empfahlen, im Wörterbuch das Wort „Entertainment“ nachzuschlagen. Was für eine Art von Unterhaltung wollen Sie Ihren Fans bieten?
de Burgh: Mir geht es beim Entertainment vor allem darum, die Leute glücklich zu machen; dass das Geld, das sie für ein Album oder ein Ticket ausgeben, es auch wert ist. Ich denke, Entertainment ist ein wichtiger Bestandteil von dem, was die Leute brauchen in ihrem täglichen Leben.
Welche Rolle spielt für Sie, das Publikum zum Nachdenken anzuregen?
de Burgh: Es gibt auf „Hands of Man“ auch den Song „Through These Eyes“, wo es genau darum geht, die Leute zum Nachdenken zu bringen. Ich erzähle von einer alten Frau im Altenheim, deren ganzes Leben nun in diesem kleinen Zimmer zusammenkommt. Da geht es mir um Respekt für alte Menschen: Wenn wir eine alte Frau sehen, wie sie langsam durch die Straße geht, darüber nachzudenken, dass sie früher ein kleines Mädchen war, dass durchs Feld lief, dass sie eine Mutter war usw. Wenn die Leute den Song einfach nur mögen, ist das ok für mich. Aber wenn sie darüber nachdenken, wenn sie das nächste Mal einem alten Menschen begegnen, freue ich mich natürlich.
Als Sie vor ein paar Jahren das Coveralbum „Footsteps 2“ veröffentlichten, gaben Sie zu Protokoll, es gäbe heute keine so guten Songwriter mehr wie Paul McCartney und Bob Dylan. Warum nicht?
de Burgh: Es gibt einen guten Grund dafür. Beim Songwriting sind wir beschränkt auf die acht Grundtöne ABCDEFG (engl. für CDEFGAH), wir sind festgenagelt auf bestimmte Akkorde und das bedeutet, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Melodien, die man erfinden kann. Deshalb war die Aufsplitterung in ganz verschiedene Stile auch sehr hilfreich für die Popmusik. Wenn heute jemand wie James Blake elektronische Musik mit alten Melodien verbindet, dann macht es daraus natürlich etwas anderes. Wenn du der Ansicht bist, dass alles schon mal dagewesen ist, dann nimmst du eben andere Zutaten.
Die Sache mit Lennon, McCartney und Dylan ist die: Sie waren die ersten, die wirklich ihre eigenen Songs schrieben und sie waren die ersten, die auf diese Melodien kamen.

© Dave Morley
Und nun ist das Repertoire von Melodien erschöpft?
de Burgh: Ja. Ich bin Songwriter und muss bei meinen Melodien sehr vorsichtig sein. Ein Beispiel: Vor ein paar Tagen habe ich eine Band gehört, die einen Song spielten, der absolut identisch war mit einem Song, den ich schon mal vor zehn Jahren gehört habe. Ich dachte, die spielen nur ein Cover, aber so war es nicht. Die Band hatte einen neuen Song geschrieben.
Ihrer Theorie folgend steckte bei Lennon, Dylan und McCartney weniger deren Genius dahinter, sondern…
de Burgh: Doch, es ist auch der Genius. Ihre Songs haben bis heute Bestand. Klar, Dylan ist ein Genie. Aber es hat auch damit zu tun, dass sie als erste den Zugriff hatten auf diese starken Melodien. Das ist sehr schwer zu wiederholen. Pop-Standards sind auf Akkorden aufgebaut und deren Anzahl ist begrenzt. Das ist in der klassischen und elektronischen Musik anders, wo die Melodie das Entscheidende ist und nicht die Akkorde.
Angeblich lesen Sie ja gar keine Noten.
de Burgh: Nein, kann ich nicht, das stimmt. Es ist alles im Kopf… Auch wenn ich mit einem Orchester arbeite, ich spreche dann mit den Arrangeuren und den Musikern und sage ihnen, was mir gefällt und was nicht. Das funktioniert.
[Das Interview entstand im September 2014]
