Herr Schaar, wieso schreibt ein langjähriger und immer noch engagierter Datenschützer ein Buch über Grundrechte?
Peter Schaar: Es ist kein Buch allein über Grundrechte, sondern es geht um Politik, darum wie die Gesellschaft sich mit Digitalisierung auseinandersetzt. Die immer effektiveren Informationstechnologien sollten nicht nur von technischen und juristischen Fachleuten behandelt werden. Sie gehören viel stärker ins Blickfeld der allgemeinen Öffentlichkeit, denn es geht darum, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Natürlich spielt dabei auch das Spannungsverhältnis zwischen Bürger- und Menschenrechten und den Sicherheitsbedürfnissen eine große Rolle – aber es geht letztlich um mehr.
Bräuchte der Datenschutz in diesem Spannungsverhältnis hierzulande mehr Gewicht, müsste er durch die Politik wichtiger genommen werden?
Schaar: Das auf jeden Fall. Wir müssen die Frage beantworten, wie viel Freiheit die Gesellschaft in Zukunft noch bietet. Gefährdungen für die Freiheitswahrnehmung kommen einerseits von Technologiekonzernen, sie kommen aber auch von staatlichen Stellen, die die technischen Möglichkeiten ebenfalls nutzen. Mehr noch: Manche Politiker instrumentalisieren die Gefährdungen, um Machtpositionen zu sichern oder auszubauen – das sehe ich kritisch.
Meinen Sie das auf Deutschland bezogen?
Schaar: Das geschieht weltweit, nicht nur bei ohnehin diktatorischen Regimes. Besonders kritisch sehe ich es, dass sich angesichts des Terrorismus auch Rechtsstaaten in eine autoritäre Richtung entwickeln – das sehen wir in den USA, aber dasselbe passiert auch in Deutschland und Europa. Freiheitsrechte werden eingeschränkt oder sogar beseitigt, im Extremfall – wie in Frankreich – bis zur Ausrufung des Ausnahmezustands, bei dem die Menschenrechte suspendiert worden sind. Kritisch sehe ich aber auch die schleichende Erosion von Grundrechten.
Zum Beispiel?
Schaar: Etwa der Verlust der Unschuldsvermutung. Damit meine ich das ziellose Überwachen und Registrieren von Menschen, unabhängig davon, was sie tatsächlich getan haben oder vermutlich tun werden, sondern allein, um zu erkennen, ob jemand irgendeine nicht gewollte oder sogar verbotene Handlung plant. Dieses Vorgehen kommt bei der Vorratsdatenspeicherung zum Tragen, bei der Speicherung von Flugpassagierdaten und nicht zuletzt bei der Videoüberwachung.
Letztere wird technisch immer weiter entwickelt…
Schaar: Diese smarten Überwachungssysteme sind nicht nur in der Lage, Menschen anhand biometrischer Merkmale zu erkennen, beispielsweise am Gesicht, sie sollen auch Menschen anhand ihres Gangs identifizieren. Zudem ermöglichen sie es, Emotionen zu erkennen und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Allerdings: Wenn jemand stark schwitzt, kann er Rad gefahren sein, oder er ist krank – die Schlüsse, die dann gezogen werden, sind nicht zwangsläufig die richtigen. Wenn immer mehr Daten gesammelt werden, können noch häufiger als bisher Personen unter falschen Verdacht geraten.
Belegen das denn auch schon reale Fälle?
Schaar: Welche gravierenden Folgen die sehr umfangreiche, häufig auf vagen Anhaltspunkten beruhende Speicherung haben kann, zeigen die Vorkommnisse am Rande des G20-Gipfels in Hamburg. Es wurden mehrere Journalisten von der Berichterstattung ausgeschlossen, zum großen Teil auf Basis falscher Informationen und zum Teil auch auf Daten, die die Behörden gar nicht hätten speichern dürfen. Ein Journalist wurde wegen einer Namensverwechslung als Reichsbürger geführt und deshalb nicht mehr zu Pressekonferenzen zugelassen. Ein anderes Beispiel ist der „Muslim-Ban“ in den USA, durch den selbst fünfjährige Kinder an der Einreise gehindert wurden, denen man beim besten Willen keine terroristischen Absichten unterstellen kann. Aufgrund pauschaler und teils unrichtiger Annahmen werden Personen als gefährlich eingestuft mit der Folge, dass ihnen dann erhebliche Nachteile entstehen.
Sind daran aber nicht eher schludrige Arbeit der Behörden schuld, und weniger die verschärften Gesetze?
Schaar: Falsche Verdächtigungen hat es natürlich auch schon früher gegeben. Wenn der Gesetzgeber aber einseitig auf neue Technologien setzt, die gewisse Ungenauigkeiten mit sich bringen, dann nimmt die Zahl der Menschen zu, die unter falschen Verdacht geraten. Das gilt etwa für die automatische Gesichtserkennung. Die Frage ist, wieviel Unschärfe man in Kauf nimmt. Sofern die Erkennungssysteme so konfiguriert werden, dass Verwechselungen, die sogenannten „false positives“, nur in extrem seltenen Fällen auftreten, werden auch Zielpersonen vielfach nicht erkannt. Angesichts des Terrorismus wird man die Erkennungsschwelle aber eher heruntersetzen, damit einem möglichst niemand entgeht. Und das führt zu vielen Fehlerkennungen.
Der gesetzgeberische Aktionismus ist kurzsichtig und unklug.
Als Alternative zur fehleranfälligen technischen Aufrüstung raten Sie in Ihrem Buch zu „intelligenterer Polizeiarbeit“.
Schaar: Damit meine ich die Konzentration auf gezielte Polizeiarbeit an Stelle immer größerer Schleppnetze und Rasterfahndungen, bei denen eine große Anzahl von Personen hängen bleiben, die nichts verbrochen haben. Bei den meisten Attentaten der letzten Zeit waren die Täter den Behörden vorher bekannt. In einigen Fällen gab es gravierende Fehleinschätzungen. So haben sich in den Monaten vor dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz viele Behörden mit der Person des Attentäters Anis Amri beschäftigt, seine Daten wurden abgeglichen, seine Telefone abgehört, sein Internetverkehr überwacht, auch seine falschen Identitäten waren den Behörden überwiegend bekannt – trotzdem wurde offenbar nichts unternommen. Dort hat kein Mangel an Informationen vorgelegen, sondern ein Mangel an Urteilsvermögen.
Was müsste sich bei der Polizeiarbeit ändern?
Schaar: Zum einen würde ich zu mehr Fortbildung und höherer Qualifikation raten. Aber es gibt auch strukturelle Mängel: Die zersplitterten Zuständigkeiten zwischen Ländern und Bund sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Zudem wird auf europäischer Ebene bei der Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung bis heute nicht wirklich intensiv zusammenarbeitet.
Warum nicht?
Schaar: Viele EU-Mitgliedsstaaten haben offenbar kein Interesse daran, Informationen mit anderen Staaten auszutauschen, zum Beispiel wenn es um Rückführungen von Geflüchteten in die Erstaufnahmeländer geht. Das Dublin-System führte fast zwangsläufig dazu, dass Staaten wie Italien und Griechenland, die den Flüchtlingsansturm in erster Linie zu bewältigen haben, nur wenige Informationen an deutsche oder andere europäische Behörden weitergegeben haben, da sie fürchten, dass weitergereiste Flüchtlinge ansonsten zu ihnen zurückgeschickt werden. Da gab es viele Informationslücken.
Wenn ich Sie richtig verstehe, fordern Sie für Deutschland aber weder eine personelle noch technische Aufstockung der Polizei…
Schaar: Natürlich gibt es Polizeibereiche, wo die Überforderung sehr groß ist, die mehr Personal brauchen, um effektiver arbeiten zu können. Aber zusätzliches Personal hilft nicht automatisch, wenn Behörden in einer Richtung praktisch blind sind und gar nicht ermitteln. Denken Sie an die rechtsterroristischen Morde der NSU – da hilft mehr Technik nur sehr begrenzt.
Im Fall Amri wurden Akten gefälscht, im Fall des NSU geschreddert. Sehen Sie Anlass, generell an der Rechtstreue von Mitarbeitern in Sicherheitsbehörden zu zweifeln?
Schaar: Ich gehe davon aus, dass sich die überwiegende Zahl der Mitarbeiter bei den Polizeibehörden rechtstreu verhält. Allerdings würde ich bei den Nachrichtendiensten meine Hand dafür nicht im gleichen Maße ins Feuer legen – da gibt es spätestens seit dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags viele offene Fragen.
Im Übrigen habe ich auch den Eindruck, dass in der Politik Grundrechte nicht immer so ernst genommen werden, wie es geboten wäre. Wenn das Bundesverfassungsgericht in immer kürzeren Abständen Gesetze für verfassungswidrig erklärt, die in die Grundrechte eingreifen, ist dies ein Alarmsignal, das speziell von der Großen Koalition viel zu wenig beachtet wurde.
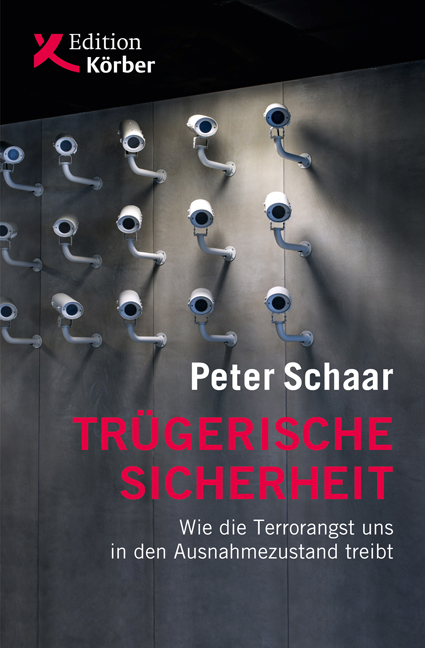 Wie müsste sich diese Weitsicht Ihrer Auffassung nach ausdrücken?
Wie müsste sich diese Weitsicht Ihrer Auffassung nach ausdrücken?
Schaar: Ich halte den gesetzgeberischen Aktionismus für kurzsichtig und unklug. Es passiert irgendwo etwas und sofort wird ein neues Gesetz gefordert – vielfach ohne zu prüfen, was denn die vielen Sicherheitsgesetze gebracht haben, die man schon verabschiedet hat.
Sie bemängeln, dass die „Evaluation“ von Gesetzen zu sehr vernachlässigt wird…
Schaar: Ja, diese Evaluation muss stattfinden, bevor ein Gesetz weitere Grundrechtseinschränkungen beschlossen wird.
Aber die Auflagen zur Überprüfung stehen doch mitunter in den Gesetzestexten selbst, sodass die neuen Regelungen explizit auf fünf Jahre begrenzt sind und danach praktisch „ungültig“ wären.
Schaar: In einige der seit 2001 beschlossenen Sicherheitsgesetze sind entsprechende Klauseln zur Evaluierung aufgekommen worden. Doch die Evaluationen, die stattgefunden haben, verdienen diese Bezeichnung nicht. Es waren zum großen Teil Selbstevaluationen jener Behörden, die die Regelungen umzusetzen hatten. Wer hat schon ein Interesse daran, das eigene Handeln negativ zu beurteilen und auf Kompetenzen freiwillig zu verzichten?
Zum Teil hat man das Evaluationsgebot auch beiseite geschoben und Gesetze wiederholt verlängert, zuletzt bis zum Jahr 2021.
Doch zu den Anti-Terror-Gesetzen hat die Bundesregierung im Dezember 2015 verlauten lassen: „Unabhängige Wissenschaftler haben die Anwendung der Gesetze durch die Behörden entsprechend den gesetzlichen Regelungen vor Fristablauf evaluiert.” – Stimmt diese Darstellung nicht?
Schaar: Die Beteiligung von Wissenschaftlern an den Evaluationsvorhaben war überwiegend rein formaler Art. Eine gründliche inhaltliche Prüfung im Hinblick auf die wirklich interessanten Fragen, was haben die Befugnisse wirklich gebracht und wie tief wurde in Grundrechte eingegriffen, hat nicht stattgefunden. Als Bundesdatenschutzbeauftragter habe ich immer wieder eine neutrale wissenschaftliche Evaluation der Sicherheitsgesetze eingefordert. Ein in meinem Auftrag erstelltes wissenschaftliches Gutachten zeigt auf, wie eine solche Prüfung erfolgen könnte. Leider wurden diese Anregungen nicht aufgegriffen.
Was ist mit folgender Annahme: Je mehr Daten die Polizei hat, desto besser wird ihre Aufklärungsarbeit.
Schaar: Es gibt bei den Sicherheitsbehörden in der Tat eine Tendenz, so viel Daten wie möglich zur Verfügung zu haben. Ich bezweifle aber, dass ihre Arbeit dadurch notwendigerweise besser wird. Bereits in den 1970er Jahren, nach der Terrorwelle der RAF, gab es Kritik an den Nachrichtendiensten, die damals riesige Datensammlungen angelegt hatten, die aber im Grunde genommen nicht aussagekräftig waren. Es wurden viele, letztlich irrelevante Informationen gesammelt, die niemand wirklich zur Kenntnis nehmen oder miteinander verbinden konnte. Infolge der Debatte wurden diese Datenbestände drastisch reduziert.
Heute werden neue technische Möglichkeiten dazu benutzt, um noch mehr Daten zu sammeln, auch wenn man noch gar nicht weiß, nach welchen Kriterien man diese filtern soll. Die Recherchen zum G20-Gipfel haben ja gezeigt, dass die Datensammlungen auf ungekannte Größenordnungen angewachsen sind.
Wie würden Sie denn handeln, wenn Sie eine Sicherheitsbehörde leiten würden?
Schaar: Für mich gilt vor allem der Grundsatz, dass der Staat, um Daten über seine Bürgerinnen und Bürger zu sammeln, in einer Begründungspflicht ist. Er darf nicht pauschal alles mögliche erheben und speichern. Eine Alternative zur Vorratsdatenspeicherung wäre das gezielte „Einfrieren“ relevanter Daten. Gerichte könnten anordnen, dass in konkreten Verdachtsfällen oder wenn eine Straftat stattgefunden hat, die relevanten Daten, die übrigens zum größten Teil ohnehin bei Unternehmen und Behörden vorhanden sind, nicht gelöscht werden dürfen. Diese „Quick Freeze“ genannte Einfrieranordnung wäre eine sinnvolle und verhältnismäßige Maßnahme. Doch stattdessen entschied sich der Gesetzgeber für die unterschiedslose Datensammlung.
Doch das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung von 2007 hatte vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand…
Schaar: Sowohl das Bundesverfassungsgericht und später noch deutlicher der Europäische Gerichtshof stellten fest, dass die Behörden und die Regierungen weder nachweisen konnten, dass diese Datensammlungen für die Ermittlungen erforderlich waren. Die Vorgabe, sie ohne unterschiedslos, ohne Zusammenhang mit einer schweren Straftat vorzuhalten, verstieß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Mehrere Mitgliedsstaaten – darunter Frankreich und Großbritannien – haben das Urteil einfach ignoriert und ihre Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung unverändert beibehalten oder sogar noch ausgeweitet. Bei uns haben die Gerichtsentscheidungen die Große Koalition nicht daran gehindert, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Inzwischen mehren sich Hinweise, dass die Gerichte auch das neue Gesetz für nicht verfassungskonform halten.
Was macht einem als Datenschützer eigentlich mehr Sorge: Paranoide Politiker oder sorglose Bürger, die ihre Daten bereitwillig überall preisgeben?
Schaar: Beides passt gut zusammen, insofern macht mir das Gesamtsystem große Sorgen. Ich denke, dass vielen Menschen, die die neuen Technologien benutzen, der Umgang mit ihren Daten nicht wirklich egal ist. Trotzdem sind viele in einer fatalistischen Weise bereit, auch solche Dienste zu nutzen, wenn die Anbieter unangemessen viele Daten sammeln und zu allen möglichen Zwecken verwenden. Es wird zu wenig über Alternativen nachgedacht. Das Modell Daten-gegen-Dienstleistung ist heute sehr beliebt. Dabei müssen Internet-Dienste nicht zwingend so gestaltet sein, dass alles über Daten bezahlt wird. Und eine Frage für die Politik ist, wie man andere, datenschutzfreundlichere Geschäftsmodelle attraktiv machen kann. Das geschieht viel zu wenig.
Weil das als Eingriff in die freie Marktwirtschaft gelten würde?
Schaar: Weil es andere Interessen gibt. Und weil der Staat, wie Bundesinnenminister de Mazière immer wieder betont hat, gerne auch an diesen großen Datensammlungen partizipieren will. Insofern gibt es ja einen engen Zusammenhang zwischen der überbordenden privaten Datensammlung durch Unternehmen und der staatlichen Überwachung. Der Staat nutzt dieselben Technologien, die eigentlich für wirtschaftliche Zwecke entwickelt wurden, oder er greift direkt auf diese Daten zu: sei es nun durch die Vordertür durch Gesetze gestützt, oder durch die Hintertür, indem er selbst zum Hacker wird, wie die NSA-Praktiken belegen.
Ist eine sogenannte Hintertür, wie sie zum Beispiel bei Whatsapp gefordert wurde, für Sie ein No-Go, weil man sie eigentlich nicht braucht?
Schaar: Es ist nicht einfach von der Hand zu weisen, dass, wenn eine verschlüsselte Kommunikation stattfindet, Behörden sich darum bemühen müssen, letztlich doch Informationen zu bekommen, etwa wenn es um Verdächtige geht, die schwerste Straftaten planen. Dass staatliche Stellen in solchen Situationen versuchen, auf gesetzlicher Grundlage Informationen zu erlangen, verstehe ich. Aber dafür Hintertüren einzufordern geht in die völlig falsche Richtung, denn niemand kann sicherstellen, dass diese Hintertüren nur von Berechtigten und nur auf Basis rechtsstaatlicher Verfahren geöffnet werden.
Wie ist es bei Ihnen, verschlüsseln Sie Ihre Kommunikation?
Schaar: Wenn man Kommunikation verschlüsseln will, gehört dazu auch der Partner und das ist leider ziemlich selten der Fall.
Aber Sie haben einen PGP-Schlüssel und Sie nutzen verschlüsselte Messengerdienste?
Schaar: Natürlich, ja, klar. Ich achte darauf und ich hoffe, dass das Überwachen dadurch schwieriger wird. Aber ich mache mir nichts vor: Wenn man Ziel einer geheimdienstlichen Ausspähmaßnahme wird, würde einem das im Zweifel auch nicht helfen.
Sollten sich die Bürger mehr mit digitaler Selbstverteidigung befassen?
Schaar: Auf der einen Seite sollten die Bürger stärker auf ihre persönlichen Informationen Acht geben, aber auf der anderen Seite würde es die meisten überfordern, die entsprechenden Techniken zu beherrschen. Niemand fordert vom Autofahrer, dass er genau weiß, wie ein Airbag funktioniert, obwohl der standardmäßig eingebaut ist. Insofern wäre mir sehr viel wohler, wenn „privacy by default“, also datenschutzgerechte Voreinstellungen zur Regel würden. Das würde etwa bedeuten, dass Kommunikationsdienste grundsätzlich verschlüsselt ausgeliefert werden. Das wäre ein wichtiger erster Schritt. In Reaktion auf die durch Snowden offenbarten Abhörpraktiken haben viele Anbieter hier schon nachgerüstet, so dass es jetzt standardmäßig mehr Datenschutz als noch vor drei Jahren gibt.
Sie kritisieren die schnelle Abfolge an immer wieder neuen Sicherheitsgesetzen. Sie waren ja selbst zehn Jahre Datenschutzbeauftragter der Bundesregierung. Wünschen Sie sich manchmal, Sie hätten das eine oder andere Gesetz besser verhindert?
Schaar: Ich war nicht Datenschutzbeauftragter der Regierung, sondern ich wurde direkt vom Bundestag gewählt und war bei der Ausübung des Amts unabhängig. Trotzdem kann ein Datenschutzbeauftragter keine Gesetze verhindern. Er kann aber dafür eintreten, auf bestimmte Maßnahmen zu verzichten. Es kommt letztlich darauf an, dass solche Forderungen aufgegriffen werden – und das ist einer bestimmten Konstellation leichter als bei anderen. Die Großen Koalitionen haben dem Datenschutz letztlich massiv geschadet.
Wobei die Große Koalition ihre Maßnahmen ja mit den Terror-Geschehnissen der letzten Monate verteidigt hat.
Schaar: Es findet eine Art Wettrennen statt um die Hoheit in der öffentlichen Wahrnehmung, da geht es nur darum, wer am Entschiedensten auftritt. Tatsächlich sind es aber Maßnahmen, die die Sicherheit nicht wirklich voranbringen. Dass die immer neueren Gesetze die Sicherheit wirklich verbessern, bezweifele ich.
Zum Beispiel?
Schaar: Das Ein- und Ausreiseregister, die Vorratsdatenspeicherung und die Fluggastdatenspeicherung treffen unterschiedslos riesige Personengruppen. Auch die immer weiter um sich greifende Videoüberwachung, einschließlich der Auswertung der Daten mittels Computersystemen bringt uns nicht wirklich die versprochene zusätzliche Sicherheit, aber mit Sicherheit mehr Überwachung.
Sie erläutern in Ihrem Buch, dass das ursprünglich nur zur Terrorismusbekämpfung vorgesehene Kontenabrufverfahren der BaFin heute von allen möglichen Behörden genutzt wird, auch von den Finanzämtern. Bedeutet dies für die Zukunft, dass Gesichtserkennung bald dafür genutzt wird, um Menschen festzusetzen, die ihre Steuererklärung noch nicht abgegeben haben?
Schaar: Das ist natürlich Spekulation. Aber die Erfahrungen legen nahe, dass es sich auch hier um einen Einstieg in eine neue Technologie handelt. Wenn die „intelligenten“ Videosysteme erstmal installiert sind, wachsen fast zwangsläufig die Begehrlichkeiten, die neuen, teureren Infrastrukturen auch umfassend zu nutzen.
Sie schreiben im Buch auch über Außenpolitik, über Asyl- und Migrationspolitik. Hier sagen manche, man hole sich mit Flüchtlingen Gefährder ins Land, während andere sagen, die werden erst zu Gefährdern, wenn sie hier nicht nachhaltig integriert werden. Wie lautet Ihre Einschätzung?
Schaar: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Mein Eindruck ist, dass die Verknüpfung dieser beiden Fragen vielfach in einer Art und Weise erfolgte, die zu Fehlschlüssen geführt hat. Dass jetzt auf die Integration bei bestimmten Gruppen ganz bewusst verzichtet wird – denken Sie an allein eingereiste junge Männer – trägt dazu bei, Gefährdung zu erhöhen.
Wenn ein Radikalisierter zum Gefährder wird, dann weiß oder lernt er, wie er sich unsichtbar machen kann. Kann man ihm dann noch mittels Datensammlung beikommen?
Schaar: Jedenfalls nicht durch die allgemeine Überwachung aller. Da muss man gezielter vorgehen und bei Personen, die Anlass zu entsprechenden Einschätzungen gegeben haben, viel genauer hinschauen. Bei Anis Amri waren viele Daten da, trotzdem waren die Einschätzungen falsch.
Wenn Personen, die sogar mit europäischem Haftbefehl gesucht werden, unter ihrer echten Identität in Europa hin- und her reisen können, dass sie ungehindert nach Ägypten und in die Türkei fliegen und wieder zurückkommen können, heißt das, dass es um die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden offensichtlich nicht gut bestellt war.
In Ihrem Buch kritisieren Sie, dass die Medien terroristische Ereignisse regelrecht inszenieren und dadurch stark überhöhen. Was sollten die Medien anders machen?
Schaar: Wenn ein Terroranschlag stattfindet, darf man es den Medien nicht verweigern, darüber zu berichten. Die Medien sollten jedoch die gezielte Dramatisierung unterlassen, Entwicklungen nüchtern und wahrheitsgemäß darstellen und Zahlen und Zusammenhänge gründlich prüfen und ordentlich aufbereiten. Hier sehe ich noch Verbesserungsmöglichkeiten.
Hätten Sie ein Beispiel dafür?
Schaar: Wenn zum Beispiel aufgrund der gestiegenen absoluten Zahl von Straftätern, die einen Migrationshintergrund haben, pauschal gesagt wird, die Ausländerkriminalität habe zugenommen ist das eine verkürzte Darstellung. Jedenfalls dann, wenn nicht darauf eingegangen wird, dass die Häufigkeit von Straftaten, bezogen auf die Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund sogar zurückgegangen ist. Wer sich mit Kriminalstatistiken beschäftigt, der weiß, dass Entwicklungen häufig falsch interpretiert oder bewusst überzeichnet werden.
Mit Ihrem Buch kritisieren Sie, dass durch die regierende Politik, auch durch die Medien, eine latente Unsicherheit bewusst „überhöht“ wird. Suggeriert aber nicht auch Ihr Buchtitel „Trügerische Sicherheit“, dass wir uns eben nicht sicher fühlen können?
Schaar: Der Titel soll das Auseinanderklaffen der Sicherheitsversprechungen und der tatsächlichen Sicherheitsgewährleistung verdeutlichen. Die schwer errungenen Bürger- und Menschenrechte müssen auch in schwierigen Zeiten Bestand haben. Das Entscheidende ist für mich ist, dass wir die Freiheit nicht für vermeintliche Sicherheit opfern dürfen und dass wir auch gelassener auf bestimmte, wenn auch schreckliche Vorfälle reagieren sollten.
Tun das die Menschen nicht sogar schon?
Schaar: Ja, die meisten Menschen reagieren auf Attentate häufig sehr besonnen und gar nicht so radikal. Das konnte man etwa im letzten Jahr in Berlin nach dem Weihnachtsmarkt-Attentat sehen und zuletzt in Barcelona. Diese Besonnenheit kommt mir in der medialen und politischen Debatte viel zu kurz, stattdessen wird die Stimmung aufgeheizt. Und dann sind letztlich doch sehr viele Menschen bereit, Einschränkungen ihrer Freiheit in Kauf zu nehmen, weil damit eben vermeintlich mehr Sicherheit geschaffen wird. Da passt für mich die Äußerung Benjamin Franklins, der sagte: „Wer die Freiheit aufgibt, um vermeintlich etwas mehr Sicherheit zu schaffen, hat weder Freiheit noch Sicherheit verdient“.

Peter Schaar ist nicht mehr im Amt.
Niemand interessiert sich für seine Meinung.