Herr Ströbele, als einer der wenigen Bundestagsabgeordneten fahren Sie meistens mit dem Fahrrad zur Arbeit, ist das richtig?
Ströbele: Ja, das trifft sogar auf den Winter zu. Ich fahre immer wenn es irgendwie geht mit dem Fahrrad, jedenfalls innerhalb der Stadt und manchmal kombiniere ich das auch mit U- oder S-Bahn. Ich habe aber auch ein Auto, seit meinem 18. Lebensjahr bin ich leidenschaftlicher Autofahrer. Trotzdem, Autofahren in der Stadt ist unvernünftig.
Von Kreuzberg müssen Sie jeden Tag raus ins edle Berlin-Mitte …
Ströbele: … nein, ich bin zwar in Kreuzberg Kandidat und jetzt Wahlkreisabgeordneter, aber ich wohne und arbeite in Mitte.
Gefällt Ihnen denn die Umgebung hier, das Regierungsviertel, das noble Jakob-Kaiser-Haus, wo Sie Ihr Abgeordneten-Büro haben?
Ströbele: Nein. Ich fand den Umzug von Bonn nach Berlin zwar vernünftig, aber dass man hier Milliarden dafür aufbringt und so viele neue Gebäude errichtet, da war ich von Anfang an dagegen. Ich habe auch nie verstanden, warum man hier dieses Großprotzige installieren musste, angesichts dessen, dass der öffentliche Haushalt so wenig Geld hat, dass wir jetzt bei den Kranken, den Arbeitslosen und überall sparen. Ich finde auch die Architektur ziemlich daneben, Sie sehen ja, dass der arme Abgeordnete seinen Interviewpartnern im Büro kaum einen Sitzplatz anbieten kann, während unheimlich viel umbauter Raum – die Flure sind ungeheuer breit – leer steht. Die Architekten wollten sich wohl ein Denkmal setzen und haben dabei weder an den öffentlichen Geldbeutel gedacht, noch an die Arbeitsbedingungen der Abgeordneten – man müsste die dazu verurteilen, hier mindestens fünf Jahre zu arbeiten. Wenn ich auf den Flur trete, dann fühle ich mich sogar an die Architektur im Knast Berlin-Tegel erinnert. Ich bin ja als Rechtsanwalt und Strafverteidiger viel in Gefängnissen gewesen und ich muss sagen, hier fehlen lediglich die Häuschen, wo dann die Wache sitzt und das Auffangnetz, um die Selbstmörder kurz vor dem Grund aufzufangen.
In das Jakob-Kaiser-Haus kommt man nicht hinein ohne Ausweis, Sicherheitsschleuse, und mit dem Pförtner kommuniziert man nur per Telefon, weil der hinter einer dicken Glasscheibe sitzt. Diese Abschottung ist nicht gerade ein Zeichen für bürgernahe Politik, oder?
Ströbele: Sie haben Recht, das schafft Distanz zwischen Politik, Politikern und der Bevölkerung. Aber wir haben wenigstens erreicht, dass wir in Berlin keine Bannmeile im alten Sinne haben, sondern dass die Demonstrationen, die ja zum Teil täglich stattfinden, relativ nah auch an den Reichstag rankommen. Es sind nicht wenige Menschen, die in die Gebäude noch reinkommen, allerdings nur nachdem sie die von Ihnen beschrieben Kontrollen über sich haben ergehen lassen. Tausende waren ja schon oben in der Reichstagskuppel und ich finde, das schafft auch ein bisschen Nähe und gleicht das ein wenig aus.
Was tun Sie selbst für bürgernahe Politik?
Ströbele: Diese Nähe stelle ich dadurch her, dass ich mich tatsächlich unter den Leuten bewege, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem Fahrrad und auch versuche in meinem Wahlkreis zugegen zu sein, im Sommer in den Biergärten und an den Tischen vor den Lokalen und im Winter auf Veranstaltungen.
Machen das viele Ihrer Kollegen?
Ströbele: Also, ich stell schon fest, dass viele aus ihren Wahlkreisen von weit her nach Berlin kommen und wenn ich die jetzt frage: "Fährst du am Wochenende in deinen Wahlkreis nach Hause?" – dann fragen die mich: "Warum nach Hause, ich wohne inzwischen in Berlin." Das finde ich eigentlich nicht richtig, wenn man aus einem Wahlkreis kommt, dann sollte man sich in der Zeit, in der man den Wahlkreis im Bundestag vertritt, auch in dem Wahlkreis aufhalten, wenn keine Sitzungswochen sind. Pro Monat gibt es meistens zwei sitzungsfreie Wochen, das sind eigentlich die Wochen, in denen sich der Abgeordnete auch um seinen Wahlkreis kümmern sollte.
Sie wurden 2002 während Ihres Wahlkampfes in Berlin von einem Neonazi attackiert, den Sie aber daraufhin selbst verfolgt haben und der schließlich von der Polizei gestellt wurde. Was hat sich bei Ihnen durch dieses Erlebnis in Sachen Bürgernähe verändert?
Ströbele: Ich gucke jetzt natürlich viel häufiger hinter mich und vom Gefühl her versuche ich so eine Art Mauer im Rücken zu haben. Es passiert mir auch hin und wieder, wenn mir im Gedrängele jemand die Tasche an den Rücken schlägt, dass ich mich dann ganz erschrocken umdrehe – aber ich versuche mich davon zu lösen und bewege mich auf Märkten oder in Fußgängerzonen ohne Rücksicht darauf.
Mitunter haben ja auch immer wieder Anhänger der Grünen kleine Attentate verübt, wie z.B. auf Joschka Fischer, der mit Farbbeuteln beworfen wurde. Wie viel Post bekommen Sie von enttäuschten Grünen-Mitgliedern?
Ströbele: Ich kriege pro Tag insgesamt zwischen 30 und 200 Zuschriften und den meisten versuche ich auch irgendeine Reaktion zu geben. Da sind auch empörte, enttäuschte Grünen- Mitglieder oder Grün-Wähler dabei. Aber deren Enttäuschung oder Wut richtet sich in der Regel nicht gegen mich. Die Mehrzahl möchte nur von mir hören, warum ich doch noch in der Partei bin, warum ich überhaupt noch weiter Politik mache …
Wie schwer haben Sie es denn heute mit Ihrer Partei?
Ströbele: Meine Position hat sich dramatisch verbessert, seitdem ich in Berlin direkt gewählt worden bin. Das verschafft mir eine sehr unabhängige Position in der Partei, in der Fraktion, weil viele anerkennen, dass ich ja für die Anti-Kriegs-Position gewählt worden bin. Wenn ich dann sage, ich stimme nach wie vor gegen den Einsatz in Afghanistan, dann wird das bei mir relativ schnell anerkannt, weil ich darauf hinweisen kann, ich bin meinem Wähler gegenüber verantwortlich. Aber natürlich bin ich auch Teil der Fraktion, ich unterstütze auch diese Regierung und natürlich mache auch ich sehr viele Kompromisse. In der Auseinandersetzung um die Hartz-Gesetze und die Agenda 2010 habe ich Kompromisse gemacht, die ich mir vorher nie habe vorstellen können. Aber es gibt, beim Thema Krieg sowieso, aber auch bei den Hartz-Gesetzen Grenzen, wo ich sage: Nein, das ist nicht notwendig und sozial ungerecht.
Aber wie viele Kollegen in Ihrer Partei gehen an solche Fragen noch mit ausreichend Gewissen heran? Schließlich haben Sie hier keinen so schlechten Arbeitsplatz als Abgeordneter, wohl kaum jemand will das missen. Wie viel spielt die Machterhaltung bei der Entscheidung jedes Abgeordneten eine Rolle?
Ströbele: Das ist eine sehr diffizile Frage. Ich denke, es ist unübersehbar, dass für viele Abgeordnete aus allen Parteien der Status, den sie in der Gesellschaft haben, und auch die finanziellen und sonstigen Wohltaten, die man als Abgeordneter hat, dass man beispielsweise jede Strecke mit einem schönen Dienstwagen fahren kann … – man kann sich an solche Sachen gewöhnen. Deshalb ist es für viele, wenn sie nicht mehr Bundestagsabgeordnete und nicht gerade Minister geworden sind, leider so, als wenn sie in ihrer Firma gekündigt worden wären, fristlos. Das ist aber die falsche Sichtweise und das wäre auch nicht im Sinne einer repräsentativen Demokratie, wo man diese Stellen immer wieder austauschen soll, weil irgendwann der eine die Interessen der Bevölkerung wieder besser vertritt als der andere.
Ich sehe schon dieses Beharrungsvermögen bei vielen Kollegen aus allen Fraktionen, die gerne ihren Arbeitsplatz behalten möchten. Aber bei den Grünen ist das noch ein anderer Mechanismus: wenn ich auf die Parteitage gegangen bin und für meine Position geworben habe, gab es von der Sache her immer riesige Zustimmung. Trotzdem sind wir dann etwa in Kriegsfragen mit 60:40 unterlegen, weil eine Mehrheit auf dem Parteitag und in der Fraktion sagt, sie will die Koalition nicht aufgeben. Das geschieht aber nicht unbedingt wegen der Machterhaltung. Delegierte haben keine Macht und auch keine riesigen, privaten Vorteile dadurch, dass die Grünen an der Regierung sind. Vielmehr sind es die Chancen, die man sieht, wenn man weiter an der Regierung bleibt, grüne Vorstellungen zu verwirklichen. Diese Chancen hätte man beim Ende der Koalition von ein auf den anderen Tag nicht mehr.
Doch wird dabei immer mehr gegen Grundsätze verstoßen, denen sich die Grünen früher fest verschrieben haben.
Ströbele: Ja, aber wenn Sie sich anschauen, jeder Abgeordnete hat in seinem Politikbereich natürlich etwas vor: der eine ist gegen Studiengebühren, der andere für Solarenergie, der dritte gegen die Atomkraft, der vierte will die gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften legalisieren … Und da gibt es durchaus in vielen Bereichen innerhalb der Koalition eine Politik, die sehr viel besser ist und viel mehr durchsetzt als das vergleichsweise bei einer CDU-Regierung geschehen würde – in einzelnen Punkten auch im Sozialbereich. Und eben dies, sagen sich viele, wäre mit einem Schlag zu Ende, wenn die Koalition zerbricht.
Muss man denn die eigenen Prinzipien auch mehr und mehr hinten anstellen aufgrund von Globalisierung, Internationalisierung und bilateralen Verträgen? Oder gibt es immer noch genug Alternativen zu einer Pro-Kriegspolitik?
Ströbele: Die gibt es auf jeden Fall. Ich habe bei jeder meiner Entscheidungen – gegen den Krieg im Kosovo, in Afghanistan und im Irak – gesagt, es gibt Alternativen. Es gab realistische Alternativen, meiner Ansicht nach auch bessere Alternativen, auch von den Erfolgschancen her gesehen. Das Regime in Afghanistan abzulösen, welches ja nun wirklich in vielen Punkten frauen- und menschenfeindlich war, dafür gab es andere Varianten, die waren realistisch und sind von Fachleuten auch vertreten worden. Aber es musste der Krieg sein. Auch beim Kosovo gab es Alternativen und beim Irak sowieso. Ich glaube schon, dass es zu dieser Pro-Kriegspolitik Alternativen gibt, in fast allen Fällen. Es gibt aber genauso Situationen, wo auch ich wahrscheinlich für den Einsatz von Soldaten stimmen würde. Zum Beispiel in Ruanda, wo ein Völkermord bereits begonnen hatte, wo die UNO abgezogen ist – da hätte man eingreifen und den 800.000 Menschen, die dort auf der Straße geschlachtet worden sind, das Leben retten müssen.
Sehen Sie heute Parallelen zwischen dem Irak-Krieg und dem Vietnam-Krieg?
Ströbele: Man darf nie vergessen, dass der Vietnam-Krieg zehn Jahre gedauert hat, von den ersten amerikanischen Einsätzen Mitte der 60er Jahre bis zum Ende des Krieges wurden wir mit einer ständigen Eskalation dieses Krieges konfrontiert. Erst waren es ein paar Hundert, ein paar Tausend und dann Hunderttausende Tote bei Flächenbombardements, Gifteinsätzen und alledem, was man damals am Fernseher schon miterleben konnte. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied zu einem Krieg, der jetzt nur wenige Tage gedauert hat und zu der Situation heute im Irak. Auch die Reaktion der Bevölkerung in Deutschland, Europa und der Welt unterscheidet sich heute von damals.
Das Fernsehen war zur Zeit des Vietnam-Kriegs noch ein sehr junges Medium. Haben die Medien damals noch jungfräulicher, unverfälschter berichtet? Und hat sich durch die heutige Berichterstattung auch etwas in der Wahrnehmung des Krieges durch die Bevölkerung verändert?
Ströbele: Ja, das denke ich schon. Erstens ist der Krieg im Irak, wie vorher auch im Kosovo oder Afghanistan, ein Krieg gewesen, der ja sehr viel weniger direkte Konfrontation gezeigt hat im Fernsehen. Man sieht nur Raketen fliegen, die von irgendwo abgefeuert und anderswo einschlagen. Während des Vietnam-Krieges war die Brutalität des Krieges natürlich viel weniger aus den Fernsehbildern wegzuretuschieren als das heute der Fall ist. Und dass die kriegführenden Nationen heute, vor allem die USA, in dieser Weise auch die Berichterstattung bis in alle Einzelheiten dirigieren und gestalten können – das war damals noch nicht möglich.
Die US-Administration hat gelernt?
Ströbele: Ja, die ganze Brutalität des Krieges erscheint ja – bis auf wenige Ausnahmen – nicht im Fernsehen. Man hat manchmal vielmehr den Eindruck, man ist in einem Videospiel: irgendwo startet eine Rakete, dort gibt es einen hellen Lichtschein, es knallt … – aber dass da jeweils Tausende von Menschen zerfetzt oder zu Krüppeln gemacht werden, ihre Wohnungen, Büros, Spielplätze zerstört werden, das kriegt man nur in wenigen Einzelfällen mit. Das war früher anders und das ist heute glaube ich auch eine der Vorraussetzungen, dass diese Kriege relativ reibungslos "verkauft" werden können.
Wo Sie gerade die grausamen Realitäten eines Krieges aufgezählt haben: im Fall des Kosovo haben grüne Politiker, also Politiker einer Partei, die sich aus einer Friedensbewegung heraus gegründet hat, für eine Kriegsbeteiligung gestimmt. Ist das für Sie ein Widerspruch gewesen?
Ströbele: Nein, die Begründung, die sich jeder Einzelne gibt, warum er dafür stimmt, die ist bei den Grünen nicht so, dass sie diese Realitäten nicht sehen oder nicht wahr haben wollen. Die Schrecken des Krieges werden schon wahrgenommen. Und beim Irak-Krieg haben wir wirklich nicht mitgemacht, was ich nach wie vor als einen Verdienst der Rot-Grünen Regierung ansehe, der unterschätzt wird. Viele haben ja noch im Wahlkampf mich immer wieder gefragt: "Wie lange haltet ihr das Nein zum Irakkrieg denn durch?" Es hat gehalten und die Regierung hat – aus welchen Gründen auch immer – in der UNO massiv dafür gekämpft, dass die USA keine Mehrheit im Weltsicherheitsrat bekommen, trotz unendlichen Drucks und trotz des unendlichen Geldeinsatzes, mit dem die USA viele Regierungen auf ihre Seite kriegen wollten. Daran sieht man meines Erachtens, dass so eine Entscheidung sehr ernst genommen wird.
Was die anderen Kriege betrifft, da hatte die persönliche Begründung immer etwas damit zu tun, dass man gesagt hat: im Kosovo sind Gräueltaten begangen worden, deshalb müssen wir jetzt da durch, die Opfer sind zwar alle ganz schlimm und schrecklich, aber wir rechtfertigen das damit, dass zukünftiger Genozid und Menschenrechtsverbrechen verhindert werden sollen. In Afghanistan war z.B. die Befreiung der Frau eine Rechtfertigung, wobei der Kampf gegen den Terrorismus dazukam. Aber so wird das zurechtgelegt und das führt dann zum Teil zu Argumentationen, wie sie beim Kosovo-Krieg gemacht wurden, wo der damalige Verteidigungsminister und der Außenminister das, was im Kosovo passierte und was man durch den Militäreinsatz nun verhindern wollte, verglichen haben mit dem, was Deutsche während des Zweiten Weltkriegs verbrochen haben.
Die einzige Sprache, die die Politiker wirklich verstehen, ist die, dass die Leute sagen: wir wählen euch nicht mehr.
Sie wurden zu Kriegszeiten geboren, 1939 in Halle. Stammt Ihre pazifistische Haltung vor allem aus der Kriegs- und Nachkriegszeit?
Ströbele: Also, ich bin kein Pazifist, dass muss ich immer gleich dazu sagen. Das heißt nicht, dass ich mich davon distanzieren will, oder die Pazifisten nicht achte. Im Gegenteil, das ist eine beachtenswerte politische und menschliche Haltung – aber es ist nicht meine. Mir hat man ja zum Beispiel in den 80er Jahren vorgeworfen, dass ich eine Geldsammlung für Waffen für das Volk in El Salvador unterstützt habe, wo es darum ging, dass das Volk sich gegen ein mörderisches Militär-Regime auflehnte und sich deswegen bewaffnet hat. Ich habe diese Sammlung für richtig gehalten, ich sehe durchaus in einzelnen Situationen, dass die Anwendung von Waffen richtig und notwendig ist.
Zu meiner persönlichen Kriegserfahrung muss ich Ihnen sagen: ich bin 1939 geboren, ich habe auch Luftangriffe auf Merseburg, Leuna und das Chemiedreieck miterlebt und habe sie auch noch in Erinnerung. Allerdings waren diese Erlebnisse nicht so, dass sie mich zu einem Pazifisten gemacht hätten. Ich war ein Junge von fünf Jahren und für mich war das damals so etwas wie ein Feuerwerk. Ich habe auch nie jemanden sterben sehen, außer einen Freund, der von einer Granate zerrissen worden ist, die wir gemeinsam gefunden hatten, aber das war nach dem Krieg.
Lassen sich denn Parallelen ziehen zwischen Ihrem Engagement in El Salvador und dem Engagement als Anwalt für Mitglieder der RAF?
Ströbele: Nein, das war etwas völlig anderes. Erstens ist es richtig und notwendig, dass jeder Angeklagte einen Verteidiger hat, möglichst einen, zu dem er Vertrauen hat – und die RAF-Leute hatten zu mir Vertrauen. Zweitens habe ich das auch als eine politische Aufgabe angesehen, die Leute aus der RAF vor den Haftbedingungen damals zu schützen und sie zu verteidigen und in den Prozessen, wenn irgendwie möglich, die politischen Hintergründe und Motivation ihrer Taten zur Geltung zu bringen.
Wie viel Sympathie hatten Sie persönlich gegenüber den RAF-Mitgliedern?
Ströbele: Ich will das an einem Vorgang erläutern: Ich bin 1975 aus der SPD – in die ich 1970 eingetreten bin – ausgeschlossen worden. Weil ich die damaligen Mandanten Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und andere in Briefen ins Gefängnis – ich war ja deren Verteidiger – als "liebe Genossen" bezeichnet habe. Das wollte die SPD, in der sich ja alle untereinander als Genossen bezeichnen, nicht hinnehmen. Warum ich das gemacht habe, haben mich alle gefragt. Ich war mit vielen von denen in Berlin auf der Straße auf vielen Demonstrationen gewesen, etwa gegen den Vietnam-Krieg oder gegen faschistische Entwicklungen in der Bundesrepublik. Wir waren in unserem Kampf gegen dieses Establishment ‚Genossen‘. Und als sie dann im Gefängnis waren, habe ich überhaupt nicht eingesehen, warum ich nun meine grundsätzliche, persönliche Haltung zu ihnen ändern sollte. Das hatte aber mit den Taten, an denen ich nicht beteiligt war und die ich auch nicht für richtig gehalten habe, überhaupt nichts zu tun.
Sie und Otto Schily haben damals eine Anwalts-Laufbahn eingeschlagen, andere sind in den Untergrund gegangen, in die RAF oder andere ‚Zellen‘. Wie haben Sie diesen Split der Bewegung, dass die einen militanter wurden und die anderen eher etwas politischer, damals bewertet?
Ströbele: Dazu muss man wissen, dass am Ende der außerparlamentarischen Bewegung Ende der 60er Jahre von sehr vielen – auch von denen, die später ganz andere Laufbahnen und Karrieren gemacht haben – die Auffassung vertreten wurde: 1. die Revolution muss gemacht werden, der Meinung war ich übrigens auch, 2. die Revolution kann gemacht werden und 3. wir sind mit unseren Demonstrationen, Teach-Ins und anderen Protestformen an einer Grenze angelangt, wo das nichts mehr nützt. Viele waren auch der Meinung, dass nur noch der bewaffnete Kampf hilft, in der ein oder anderen Variante. Einige haben das dann in die Tat umgesetzt und es war Anfang der 70er Jahre lange Zeit so, dass Aktionen wie das Molotow-Cocktail-Werfen gegen staatliche Gebäude in Berlin auf ein gewisses Verständnis in Teilen der außerparlamentarischen Linken gestoßen sind, auch bei vielen, die sich bereits in Institutionen oder im Beruf etabliert hatten. Für mich war das nicht der richtige Weg. Ich habe solche Aktionen völlig anders gesehen als sie heute geschildert werden, wo es heißt, das seien alles nur Verrückte oder Kriminelle gewesen, die einfach nur brandschatzen, morden und rauben wollten. Das war nicht so. Aber für richtig gehalten habe ich diese Aktionen nicht.
Inwiefern teilen Sie die Auffassung, dass die militante Bewegung damals auch ein Stückweit instrumentalisiert wurde …
Ströbele: … von den Geheimdiensten und dem BKA? Natürlich haben die das alles genutzt um das Bundeskriminalamt zu einer riesigen Behörde aufzubauen, das Personal wurde verzehnfacht, die Geldmittel wurden verzehnfacht. Es hat eine ungeheure Aufrüstung auch im Bereich der Gesetze stattgefunden bis Ende der 70er Jahre, Gesetze, von denen noch alle in Kraft sind. Ob das nun ein bewusstes Schüren war? Was nicht richtig ist, sind Behauptungen, dass bestimmte Aktionen, auch Morde, zu denen sich die RAF bekannt hat, vom Geheimdienst verübt worden sein sollen. Dafür waren die Leute aus der RAF viel zu politisch, als dass sie in so einem Fall nicht gesagt hätten: "Das waren nicht wir".
Kommen wir zu den heutigen Protesten. Wenn in Berlin mehrere Hunderttausende auf die Straße gehen und beispielsweise gegen Kürzungen im Sozial-Bereich protestieren – spielen diese Proteste für die Bundestagsabgeordneten intern überhaupt eine große Rolle oder sind das eher nur Randnotizen im parlamentarischen Alltag?
Ströbele: Die Anti-Kriegs-Demonstrationen im vergangenen Jahr haben nachhaltige Wirkung gehabt. Ich habe in einer Reihe von Veranstaltungen jungen Schülern, die ganz frustriert waren, weil der Krieg nun doch nicht verhindert werden konnte, obwohl sie hier mit 25.000 auf der Straße waren, gesagt: "Da täuscht ihr euch". Natürlich ist es nicht so, dass eine Demonstration stattfindet und deshalb anschließend der Krieg abgeblasen wird, der schon geplant worden ist. So läuft das nicht. Aber, es war ein ganz wichtiges Argument in der Diskussion, wenn 100.000 oder mehr auf der Strasse waren. Das ist ein Signal für die Politik, sich entsprechend zu korrigieren – das habe ich auch direkt miterlebt. Deshalb kann man nur alle immer wieder ermutigen, da nicht nachzulassen. Natürlich kann man nicht jahrelang jede Woche demonstrieren. Aber solche Aktionen, wenn sie länger anhalten und wenn sich viele daran beteiligen, haben Auswirkungen in der Politik, gerade wenn Parteien die Regierung stellen, die von ihrer ganzen sozialen und gesellschaftlichen Herkunft her aus diesen Bereichen und Bewegungen irgendwann mal hervorgegangen sind. Das war glaube ich schon in den 70er und 80er Jahren so, dass die SPD viel mehr von Demonstrationen beeindruckt war, als die CDU; oder gar die FDP – denen ist das doch egal. Bei der SPD ist das auch heute noch so und ich selbst bin jemand, der versucht, so oft es geht, zu den Demonstrationen hinzugehen.
Kann es aber sein, dass ein Umdenken bei vielen Politikern vor allem erst dann stattfindet, wenn sie angesichts großer Demonstrationen befürchten, dass ihre Umfrage-Werte sinken, von denen wiederum die Erhaltung ihrer Macht abhängt?
Ströbele: Nein, da geht es nicht nur um Machterhaltung, im Gegenteil, ich finde das zutiefst demokratisch. Die einzige Sprache, die die Politiker – wenn sie mal hier im Bundestag oder in der Regierung sitzen – wirklich verstehen, ist die, dass die Leute sagen "wir wählen euch nicht mehr." Und was signalisiert ihnen, dass sie nicht mehr gewählt werden? Erstens die Umfragewerte und zweitens natürlich auch, wenn aus der eigenen Wählerschaft Hunderttausende auf der Straße sind aus Protest gegen ihre Politik. Das macht natürlich Eindruck.
Um die vorige Frage einmal anders zu formulieren, was spielt für einen Politiker die größere Rolle: das Allgemeinwohl oder die Umfragewerte?
Ströbele: Also, die Politiker sagen vor sich selber, dass sie das Beste für das Gemeinwohl tun. Subjektiv gesehen ist das wohl auch so. Die sind der Meinung, selbst wenn wir jetzt Grausamkeiten wie bei der Gesundheitsreform und bei den Arbeitslosen machen, dann machen wir das letztlich im Interesse des Wohl des Volkes. Aber direkter wirken natürlich, Umfrage- oder Wahlergebnisse.
Und oft hat es den Anschein, dass ein Politiker zuerst guckt, was er tun muss, um an der Macht zu bleiben und sich dann erst der Frage nach dem Gemeinwohl stellt.
Ströbele: Nein, wenn Sie einmal irgendeinen Politiker fragen, was seine Triebfeder ist, der wird Ihnen sagen, aus tiefster Überzeugung: "Das, was ich hier mache, das mache ich insgesamt im wohlverstandenen Interesse der Bevölkerung und des Gemeinwohls. Ich mache sicherlich hin und wieder Kompromisse, weil es anderes nicht durchsetzbar ist und wir müssen erst mal durch diese Täler durch, damit wir anschließend wieder unendlich viel zusätzliche Arbeitsplätze bekommen, die Konjunktur wieder anzieht und all diese Grausamkeiten und Verwundungen geheilt werden."
Halten Sie denn zum Beispiel die Zumutbarkeitsregelung mit dem Gemeinwohl für vereinbar?
Ströbele: Nein, ich selber habe ja auch, als es dann zu weit ging, dagegen gestimmt. Aber die Philosophie, wie das andere Politiker vor sich selber rechtfertigen ist eine andere. Die sehen die Grausamkeit und diese Härte auch, aber sie sagen, diese Härte muss sein, damit wir danach wieder in glücklichere Zonen kommen.
Nur werden die Politiker, die darüber entscheiden, diese Regelung ja nie selbst zu spüren bekommen.
Ströbele: Ja, aber das ist denen trotzdem nicht egal, also jedenfalls bei den Kollegen, mit denen ich darüber streite und diskutiere, ist das anders. Hier sitzen doch nicht eine Riege von grausamen Leuten, die nur ihre Privilegien behalten wollen und deshalb der Bevölkerung alles böse zumuten.
Wie erklären Sie sich, dass trotz zum Teil massiver Einschnitte unter der Bevölkerung so etwas wie Politikmüdigkeit herrscht?
Ströbele: Das hängt erstens damit zusammen, dass alles sehr kompliziert ist und keiner mehr richtig durchblickt – auch die meisten Abgeordneten nicht. Zweitens merken die Leute ja Dinge wie die Praxisgebühr erst, wenn sie selbst zum Arzt gehen und diese 10Euro hinlegen müssen. Da hatte man vorher mal etwas von gehört, aber in dem Moment, wo es so ganz praktisch wird, bemerken die Leute all das, was sie in vielen theoretischen Diskussionen z.B. bei Frau Christiansen gehört haben und nie ganz richtig verstanden haben. Was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem, was der eine und was der andere Politiker sagt. Es ist ja auch sehr kompliziert. Vieles von dem, ich habe ja die interne Diskussion mitbekommen, haben selbst die Fachleute so nicht überschaut und vorhergesehen.
Aber zu der Politikmüdigkeit kommt ja noch hinzu: die Leute glauben den Politikern nicht mehr – und das zu Recht. Es gibt unendlich viele Beispiele, wo ich selber überhaupt nicht verstehe, wie das möglich ist: dass Politiker heute mit dem Brustton der Überzeugung etwas sagen, was in einer Woche oder einem Monat einfach nicht mehr wahr sein soll und die gleiche Person das Gegenteil erzählt.
Davon gibt es aber wohl leider in allen Parteien betreffende Beispiele.
Ströbele: Ja. Ich finde, man soll den Leuten sagen, was schlimm wird und was grausam wird. Aber nicht wie zum Beispiel in der Diskussion um den Zahnersatz, wo an einem Tag gesagt wurde: "Das werden wir nie zulassen, dass man an den Gebissen erkennt aus welcher sozial schwachen Schicht jemand kommt." Und zwei Monate später beschließt man, die Leute müssen den Zahnersatz nun selber bezahlen, oder einen Teil davon, was natürlich heißt, dass das viele nicht können und dass man es dann doch an den Gebissen erkennt. Da bekommen die Leute zurecht den Eindruck, dass es Politiker gibt, die sich in der Politik verhalten, wie sie es sich in der Familie oder in ihrem Freundeskreis niemals leisten könnten. Die sagen heute das und morgen das Gegenteil davon – da würde doch die Familie revoltieren.
Und wo sehen Sie Gründe für dieses Verhalten?
Ströbele: Da müssen Sie die fragen, die das tun.
Ist es nicht in bestimmten Fällen die Machterhaltung?
Ströbele: Nein, das ist doch auch dumm, das trägt doch zur Machterhaltung überhaupt nicht bei, sondern ist kontraproduktiv. Nehmen wir mal die ganze Kündigungsschutz-Debatte. Man kann darüber diskutieren, ob der Kündigungsschutz in Deutschland zu weit geht. Aber was man nicht machen kann, vor der Wahl auf unendlich vielen Veranstaltungen sagen "wenn ihr mich wählt, wird sich am Kündigungsschutz in Deutschland nichts ändern" und zwei Monate nach der Wahl eine Gesetzesvorlage machen, wonach der Kündigungsschutz auf einmal geändert wird. Ich würde sagen, in dieser Legislaturperiode können wir da nicht ran, erst zur nächsten Bundestagswahl können wir uns überlegen, ob wir beim Kündigungsschutz dieses oder jenes ändern wollen. Aber ohne jeden Erklärungsversuch stellen sich die Politiker dann hin und tun so, als wenn sie das vor der Wahl überhaupt nicht gesagt hätten. Oder nehmen Sie das Bombodrom. Vor der Wahl 1998 haben Politiker, die später Minister wurden, gesagt: Mit uns wird es einen Bombenabwurfplatz in der Kyritzer Heide nicht geben. Heute, als Minister, versuchen sie genau das durchzusetzen, was sie versprochen haben zu verhindern.
Wenn Sie auf Ihre Laufbahn zurückschauen – wie empfinden Sie das, dass Sie heute hier im Regierungsviertel ehemalige Weggefährten, zum Teil auch in anderen politischen Lagern, antreffen?
Ströbele: Das empfinde ich persönlich als etwas ganz normales.
Auch wenn es ganz unterschiedliche Wege genommen hat?
Ströbele: Also, wenn dann bestimmte Entscheidungen getroffen werden oder Reden gehalten werden, wo ich überhaupt nicht verstehe, warum einer so etwas plötzlich sagt – natürlich stößt mir das dann auf und ich frage mich, was mit dem passiert ist. Hat er das, was er vor zehn Jahren mit mir gemeinsam verfochten hat, nicht ernst gemeint, oder warum sagt er das jetzt?
Trifft man sich denn manchmal abends nach den Sitzungen, gibt es da vielleicht auch noch Freundschaften, oder gehen alle ihre getrennten Wege?
Ströbele: Also, auf der Bundesebene ist letztere Variante die zutreffende. Man sieht sich bei Abstimmungen im Bundestag, man sagt sich irgendwo mal ‚Guten Tag‘, aber eine Diskussion oder Auseinandersetzung findet nicht statt.
Bedauern Sie das oder ist das normal?
Ströbele: Das ist sicher anomal. Aber es ist so.
Eine Schlussfrage: Wen würden Sie gerne noch treffen in Ihrem Leben, egal ob nun eine lebende oder bereits verstorbene Person?
Ströbele: Nun, ich glaube schon, dass die Politik in Deutschland, auch bei den Grünen, ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn Rudi Dutschke heute noch da wäre. Ich habe ihn sehr geschätzt, vor allem die Konstanz in seinen politischen Erkenntnissen und in seinem politischen Handeln. Als er Jahre nach dem Attentat plötzlich zu Weihnachten verstarb war er ja gerade in der allerersten Phase der Grünen dabei gewesen, er war in der Gründungsphase mitbeteiligt und ich habe da auch häufiger mit ihm gesprochen. Ich habe seinen Tod sehr bedauert und wenn ich mir heute vorstelle, er wäre vielleicht hier im Bundestag oder sogar in der Regierung – da könnte ich mir nicht vorstellen, dass Rudi Dutschke Veränderungen gemacht hätte, wie sie heute von so manch anderem Politiker gemacht werden.
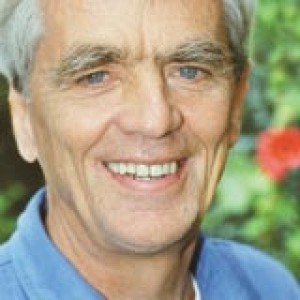
>>zu MdB Ströbele, ein Grüner
..hoplla z: zum vorigen Beitrag nur noch mein Name: Retnüg Grebnellusch
Christian Ströbele, ein Grüner MdB, seine Ansichten
Es ist immer wieder „wohltuend“ welche Ansichten er als selbsternannter Gutmensch zu allem hat.Im Presseclub sonntags um 12 Uhr hörte ich neulich, „..man muss davon ausgehen, dass die Welt ungerecht“ ist, dann kann man vieles besser verstehen….“ Der Grüne MdB Ströbele geht aber davon aus, das der Mensch grundsätzlich gut ist und da liegt sein Denkfehler in der Prämisse. Und das Prädikat, dass ein Politiker „ehrlich“ ist, ist unter diesen Auspizien also naiv. In jeder Partei, Vereinigung usw. muss um Mehrheiten gerungen werden, oder wollen sich seine Befürworter alles von einem sagen wollen. Mein geliebter Kurt Tucholsky schrieb sinngemäß: „……er war so ehrlich, wie er dumm war und er war sehr ehrlich!“ Der Antisemit u.Exminister Norbert Blüm galt auch als „ehrlich“, weil er sagte, „die Rente ist sicher!“ Er wurde gefeiert als „erhlicher“ Politiker, aber die Dummen merkten nicht, dass er ja niemals eine Zahl sagte.
go on ströbi
Es ist schön zu wissen das, egal wie grün die Bundestagsfraktion der Grünen momentan noch ist, es Einen gibt der hunderprozentig die grünen Ideale und, vielleicht noch wichtiger, seine eigenen Ideale vertritt.
Das ist noch einer…
der wenigen Politiker, die ehrlich sind. Einer, der voll hinter seiner Politik steht, weil ER so denkt, und nicht weil er dafür bezahlt wird (Von wem auch immer).
Ich hoffe, er macht noch lange weiter.