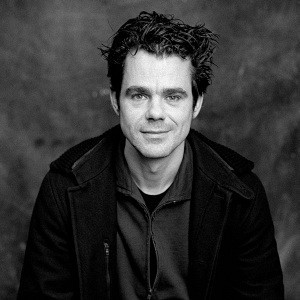Herr Tykwer, Sie haben sich in Ihrem neuen Film einer ménage à trois gewidmet. Ist es Ihnen nach „Lola rennt“ und „Heaven“ langweilig geworden, nur von Paaren zu erzählen, oder steckt dahinter eine reale Neugier auf andere Möglichkeiten von Beziehungen?
Ich hatte tatsächlich nie vor, eine Dreiecksbeziehung zu inszenieren. Der Film hätte zunächst eher „Zwei“ heißen müssen, weil ich über ein paar Jahre hinweg Materialien, Puzzlestücke über Beziehungen gesammelt hatte, die man gemeinhin als Langzeitbeziehungen bezeichnet. Das heißt, dass Paare einen Punkt überschritten haben, an dem das Feuer noch brennt und die Leidenschaft noch Kapriolen schlägt. Die haben sich auf eine Weise miteinander eingerichtet, die man nicht nur als demoralisiert und trotthaft empfinden muss. Es ging vielmehr um Leute, die einen Weg gefunden haben, auch über eine lange Zeit hinweg zusammen zu bleiben.
Wodurch zeichnen sich solche Beziehungen aus?
Man liebt sich noch, ist auf Augenhöhe, kann noch miteinander streiten und einfach miteinander sein. Mit dem Verlust ihrer Neugier und ihrer Geheimnisse haben diese Paare natürlich trotzdem zu kämpfen. Da kommt es zu sehr vielen lustigen, eigentümlichen, interessanten Situationen, die wir zusammengetragen haben, aber das alles war noch kein Film. Und es wurde – Oh Wunder! – dadurch ein Film, dass ein Dritter ins Spiel kommt.
Das ist erstmal in der Tat keine besonders originelle Idee.
Aber dann kam die Beobachtung hinzu, dass Paare, die lange zusammen sind, sich immer ähnlicher werden – oft sogar optisch, aber vor allem von ihrer Art her. Man entwickelt vergleichbare Marotten, man hat sowas Geschwisterhaftes. Paare entwickeln oft gemeinsame Interessen, aber auch die selben, fast identischen Defizite. Wenn man das ernst nimmt, heißt das auch, dass sie sich in die selben Personen verlieben können. Genau das passiert in unserem Film. Der Dritte weiß gar nichts von seinem Glück, dass er gerade Affären mit zwei Menschen hat, die ein altgedientes Pärchen sind. Daraus zieht der Film dann seine spezifische Dynamik.
Simon, einer der Hauptcharaktere in „Drei“, geht nicht nur fremd, er hat dadurch gleichzeitig seine erste homosexuelle Erfahrung. Es ist fast beruhigend, dass auch ihm das nicht so routiniert gelingt, wie man es bei dem aufgeklärten, progressiven Künstlermilieu, in dem er sich bewegt, zunächst annehmen könnte.
Ja, die Menschen in diesem Film halten sich für ziemliche reflektiert und sind das wahrscheinlich sogar. Sie sind halbwegs auf der Höhe spätmoderner Debatten und wissenschaftlicher Erkenntnisse und sie versuchen das einzubeziehen, nicht nur in ihr Bewusstsein sondern eben auch in ihrem Alltag. Aber dort stoßen sie dann an ganz bestimmte Grenzen. Wenn man wirklich auf sich anwenden will, dass Monogamie nichts ist, was uns biologisch mitgegeben wurde, sondern dass wir von unserer Natur her zum Gegenteil neigen, bekommt man es leicht mit der Angst zu tun. Wir haben eben diesen absurden Widerspruch in uns, dass wir uns als polygame Wesen in die beschützte Zelle einer trauten Zweisamkeit zurückziehen wollen. Dieses Spannungsfeld ist interessant und ich finde es wichtig und ein wenig unterthematisiert, dass ein Seitensprung fast allen irgendwann mal passiert, dass man aber deshalb nicht unbedingt aufhört, den Partner zu lieben, oder sogar noch zu begehren. Natürlich ist dieses Begehren ein anderes bei jemandem, den man seit 15 Jahren kennt, als bei jemandem, der einem letzte Woche zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist. Da sind viel mehr Projektionen und Geheimnisse im Spiel. Diesen Energien folgt der Film, sowohl was die Personen, als auch, was die Erzählhaltung betrifft. Der Film geht Umwege.
Und manche Situation, die wie eine Sackgasse für ein Paar wirkt, entpuppt sich plötzlich als Ausweg.
Das ist eben auch eine alte Weisheit: durch das Aufreißen des Horizonts lässt sich der Blick neu auf das Vertraute richten. Und plötzlich werden wieder Spannungsfelder erzeugt, die man fast schon vergessen hatte, immer vorausgesetzt natürlich, dass man den anderen noch liebt. Dass man den Partner für sich genommen noch attraktiv findet, kann man interessanter Weise oft reaktivieren, auch wenn man es durch Trott und Gewohnheit ein bisschen vergessen hatte.
Ist „Drei“ auch ein Plädoyer dafür, die eigene festgelegte sexuelle Orientierung zu hinterfragen?
Ich empfinde den Film natürlich nicht als Plädoyer. Der spielt mit der Frage: wie hetero oder homo bin ich eigentlich? Er lässt seine Figuren in diese Komplikationen hineinrennen und wir haben uns wirklich sehr darum bemüht, dass in einer Weise zu tun, die leicht ist und nicht so angespannt oder schwerblütig. Denn es ist eben auch wahnsinnig komisch, wie wir zwischen unseren festgelegten Dogmen und unseren darüber hinaus schießenden Bedürfnissen hin und her pendeln und einen relativen Aberwitz veranstalten, um dabei das Gleichgewicht zu halten.
Aber in seiner Infragestellung des Konzeptes Kleinfamilie ist "Drei" schon sehr eindeutig.
Es kann ja auch nicht unser Ernst sein, dass wir bis ans Ende unserer Tage die Kleinfamilie als das Ideal hochhalten. Wir sind schon so lange an diese ganz gut zu organisierende Lebensform gewöhnt und fast genetisch auf sie getrimmt, dass es fast wie ein Evolutionssprung wirkt, wenn man da mal raus will. Aber den Impuls kennt jeder und der ist ja nicht bloß auf unser Beziehungsleben bezogen, der Film handelt eigentlich eher vom so genannten Erwachsensein.
Wann ist man eigentlich erwachsen?
In der Regel wird man erwachsen gemacht. Andere sagen einem: Du bist jetzt erwachsen. Man hat sich entschieden, wie man sein will, für einen Beruf, für eine Lebensform, man kennt seine Begehren. Nur der Anspruch, dann auch für den Rest des Lebens bei all dem zu bleiben stürzt uns regelmäßig in Krisen.
Festgelegt sind wir, glaube ich, nicht.
Dass, was man früher Midlife-Crisis nannte, ist zum manchmal verdrängten, aber doch permanenten Zustand geworden?
Das fängt ja viel früher an. Ich kenne massenhaft Ende 20- Anfang 30jährige, die damit Probleme haben, dass es so eine Festlegungsstrategie gibt, die gesellschaftlich auf einen zu rennt und vor der man eigentlich nur wegrennen möchte, weil man von seiner Grunddisposition eine Sehnsucht nach ständiger Erneuerung, Transition und Transformation hat. Es gibt eine Lust, nicht zu stagnieren, logischerweise auch, weil eine Stagnation uns immer daran erinnert: wenn das jetzt so bleibt, wartet danach nur noch der Tod. Dann stirbt man und hat am Ende immer nur das selbe gemacht. Das treibt einen ständig an, vielleicht doch noch mal was anderes zu probieren, als könnte man die Zeit, die einem auf diesem Planeten bleibt, dadurch ausdehnen. Unter diesem Spannungsfeld leiden wir alle ganz furchtbar, das endet nie und wir machen die aberwitzigsten Versuche, was neues zu probieren. Und trotzdem landen wir immer wieder in diesen traditionellen Kisten, die natürlich auch Schutz bieten.
Simon, der von Sebastian Schipper gespielt wird, hätte vielleicht nicht den Mut gehabt, etwas neues zu probieren, wenn er nicht selbst mit Tod und Krankheit konfrontiert worden wäre.
Das ist ja jetzt auch keine besonders aufregende dramaturgische Pirouette, dass Menschen, die einen Schicksalsschlag erleiden, sich insgesamt noch mal in Frage stellen. Habe ich eigentlich alles probiert, was ich wollte? Je älter man wird, desto öfter fragt man sich das und es gibt immer Fantasien, die man noch nicht ausgelebt hat. In „Drei“ bezieht sich das auf alle möglichen Dinge, aber eben auch auf sexuelle Dispositionen. Inzwischen behauptet, glaube ich, niemand mehr, er sei hundertprozentig homo- oder heterosexuell. Wir alle pegeln uns irgendwo dazwischen ein. Früher hat man dann doch gesagt: das ist so meine feminine Seite. In Wahrheit ist diese Uneindeutigkeit natürlich etwas, das uns als sexuell disponiertes Wesen einfach offener macht. Aber diese Offenheit passt nicht dazu, wie die Gesellschaft organisiert ist. Da muss man sich eben festlegen und bekommt eventuell etwas aufgezwungen, in dem man sich gar nicht ganz zuhause fühlt.
Auch als Genre lässt sich „Drei“ nicht festlegen, liegt irgendwo zwischen Drama und Komödie.
Der Film bedient sich einer Dramaturgie, die er eher dem Leben entnimmt, als diesen strengeren Normen, die es in Filmerzählungen so gibt. Das Leben hat eine extrem chaotische und äußerst kontingente Struktur. Heute passiert etwas, womit ich gestern nie hätte rechnen können. Dramen sind ja meistens deshalb Dramen, weil sie über uns herfallen, ohne dass wir uns auf sie hätten vorbereiten können. Dass unsere Eltern eines Tages sterben müssen, ist das natürlichste von der Welt. Und wenn das in eine Geschichte eintritt, die gerade eher eine romantische Komödie zu werden versprach, dann ist das halt so. Alles andere wird dann weniger wichtig, egal, wie groß unsere Sorgen gerade sonst sind, egal, was einen sonst so beschäftigt. Der Film nimmt das ernst, nimmt sich Zeit dafür. Deswegen gibt es diesen mäandernden Fluss im Film, keine strenge, plotgetriebene Maschine, die ihre einzelnen Akte durchpeitscht. Das gefällt mir, weil es so ein Film geworden ist, der mit unserer Wirklichkeit zu tun hat und ihr nicht so sehr ein äußeres Format aufzwängt.
Zurück zur Frage: Wann ist man erwachsen? Wenn die Eltern gestorben sind?
Wir – ich sage jetzt mal: als Europäer – sind ja alle mindestens im Zeitalter der erwachenden und dann sich durchsetzenden Popkultur aufgewachsen. Pop als Kriterium, das uns mitgeprägt hat, das die Politik verändert hat, das unseren Alltag auf kreative Weise usurpiert – da ist zumindest meine Elterngeneration schon stark hingewachsen. Eine Generation zuvor waren Eltern und Kind noch ganz sauber voneinander getrennt. Auch die Idee vom Erwachsensein war ästhetisch und formal zuvor anders markiert. Heute gibt es so viele Eltern-Kind-Beziehungen, die eine große freundschaftliche Dimension haben, das drückt sich in dem Film ja auch aus.
Zum Beispiel durch den Song „Space Oddity“, der den ganzen Film durchzieht.
Ja, wir wollten unbedingt einen repräsentativen Song in dem Film unterbringen und dafür fiel eben die Wahl auf dieses Stück von David Bowie. Man findet 70jährige, die das Stück von damals noch kennen – es ist wirklich vierzig Jahre alt, man glaubt es kaum – aber man findet auch junge Pop-Fans, die das Stück genauso cool finden und immer noch gerne hören; es ist ein Song der absolut zeitlos ist, der immer wieder relevant wird. Und die Idee des Film war sozusagen: erwachsen sind wir alle, wenn wir anfangen, das Leben nicht von der Geburt weg, sondern eben auf den Tod hin zu leben. Das ist ein Punkt, der erwischt uns eben eines Tages. Aber zugleich halten wir auch an der Idee von einem undefinierten, nicht zu sehr eingegrenzten Lebenskonzept fest. Man trifft ja heute immer wieder das, was man in einer so etwas spöttischen Konnotation „Berufsjugendliche“ nennt. Leute, wie Daniel Cohn-Bendit, die auch mit 70 noch in der Jeans in der Talkshow sitzen und auf eine Weise reden, die uns sehr vertraut ist, die auch dreißig Jahre Jüngere noch drauf hätten. Da hat so eine Überlagerung stattgefunden, die ich sehr interessant finde und auch zu anderen Konflikten führt. Deswegen ist „Drei“ auch kein Film über eine bestimmte Generation, sondern über Leute, die gewisse Probleme haben. Wir hatten einfach Lust auf einen Film, der mit einer gewissen Basishoffnung operiert und seine Geschichte auf eine Weise behandelt, die nicht fatalistisch ist, sonder den Raum vor der immer näher rückenden Todesrealität wenigstens mit möglichst viel experimenteller Lust füllt.
Die Realität einer nachwachsenden Generation, selber Kinder zu bekommen, spielt da zunächst keine Rolle, scheint aber doch, wie ein blinder Fleck, wie ein Wunsch, den man sich nicht eingesteht, immer vorhanden zu sein.
Ohne dass das irgendeinen konzeptionellen Grund hatte, sollte „Drei“ von einem Paar handeln, das ohne Kinder lebt. Alles wäre anders, wenn sie Kinder hätten. Dann hätten sie wahrscheinlich einen anderen Weg beschritten. Dass sie relativ spät erst ein Kind bekommen, ist auch ein Ausdruck des Gegenwartsbezugs des Films. Es wird heute immer normaler, dass man, wenn man über 40 ist, noch darüber nachdenken kann, Kinder zu haben. Da wurde man früher schon Großvater.
Sie sind selbst vor kurzer Zeit zum ersten mal Vater geworden. Wie hat Sie das verändert?
Das kann man nicht so zusammenfassen. Kinderkriegen verändert ja alle und alles. Das ist ja eine Binsenweisheit, dass dadurch eine Verantwortungs- und Zugehörigkeitsfrage neu gestellt wird und man findet sich plötzlich in einem neuen Kontext, in dem man einen etwas chaotischeren Lebensraum gegen eine organisiertere Welt eintauscht, weil das Kind die einfach braucht. Es ist für mich interessant zu beobachten, wie uns die Evolution einerseits dafür stark macht und uns andererseits da ins Messer laufen lässt – ins Messer der Sorgen, die einen da erwarten.
Heißt das, in dem Projekt „Vater sein“ entlarven sich die Schwächen jeder Theorie?
Theorie ist wichtig, um sich überhaupt ein Bewusstsein zu verschaffen. Aber natürlich ist der Übergang in die Konkretion und ins Handeln begleitet von ganz Vielem, das diffus und unbewusst ist, von unseren Neurosen und Alltagsängsten, die wir nicht auch noch alle mit analysieren können. Die schleppen wir in jeden Gedanken und auch in jede Lebensentscheidung mit hinein und diese Melange ist das, was uns zur Person macht. Man möchte ja so viel wie möglich erkennen und sich selber so gut wie möglich kennenlernen – und trotzdem wird uns immer etwas einfach durchs Erkenntnissieb rutschen. Als Instinkt und auch als unlenkbares Etwas treibt es uns in eine andere Richtung, obwohl unser Bewusstsein das nicht in Ordnung findet.
David Bowie war ja berühmt dafür, sich als Künstler immer wieder neu zu erfinden, sein Image zu wechseln. Das passt zu einem weiteren Thema, das in „Drei“ eher beiläufig behandelt wird: der Umgang mit künstlich gezeugten Embryonen, mit dem substantiellen Eingriff des Menschen in Erbanlagen. Sind Sie diesen Möglichkeiten gegenüber eher skeptisch oder macht Sie das vor allem neugierig?
Ein paar Szenen des Film spielen im Nationalen Ethikrat, wo diese Fragen behandelt werden und dieser Rat ist wirklich ein ziemlich interessantes Organ, in dem ganz offen diskutiert wird. Ich bin extrem neugierig, immer. Und ich finde es albern, sich diesen ganzen Überlegungen zu versperren, was manchmal in so einem religiösen Kontexten verordnet wird. Wir sind schon mittendrin in einer Lawine wissenschaftlicher Fortschritte, die uns auch noch in unserer Lebenszeit mit extremen Fragestellungen konfrontieren wird. Ich bin sehr offen dafür und habe große Lust daran, dass wir ein entspannteres Verhältnis zum gestalteten Körper kriegen. Der gestaltete Körper ist auch eine Befreiung, eine Befreiung von der Idee, festgelegt zu sein. Und festgelegt sind wir, glaube ich, nicht.