Wallis, nach Ihrem letzten Album 2012 sind Sie von London nach Berlin gezogen. Warum eigentlich?
Wallis Bird: Das erste, was dich die Leute in London fragen ist: Womit verdienst du deinen Lebensunterhalt? Es geht in London nicht darum, das Leben zu genießen, sondern darum, soviel zu schuften, dass du dir das Leben und die richtigen Klamotten dort leisten kannst. Das ist eine sehr oberflächliche Haltung. Es ist dort sehr hart und es braucht Jahre, Menschen wirklich kennenzulernen, sich einen Freundeskreis aufzubauen. Es ist dort sehr konkurrenzbestimmt. Und als Künstler bringt mich diese Haltung dazu, die Flucht zu ergreifen. Meine Inspiration kommt nicht aus dem Konkurrenzdenken.
Gibt es trotzdem etwas, das Berlin von London lernen sollte?
Bird: Nein. Ganz ehrlich, ich glaube London hat eine Menge von Berlin zu lernen. In Berlin kannst du dir einfach Zeit nehmen und tun was du willst. London ist eine sehr voreingenommene, eine kalte Stadt, in der du permanent der Bewertung durch andere ausgesetzt bist. London ist zu prätentiös, die Stadt hält sich für viel wichtiger, als sie ist. Man hält sich auch für den Mittelpunkt der Kunstwelt. Und dann kommst du nach Berlin und merkst: Verdammt, in dieser Stadt ist eigentlich jeder ein Künstler. Hier hat jeder seinen Namen schon mal auf eine Mauer geschrieben.
Sie meinen, es gibt keine Streetart in London?
Bird: Oh doch, aber sie ist schrecklich. Hier in Berlin ist sie wunderschön. Das ist mir gleich aufgefallen und ich dachte nur: Ich liebe diese Stadt, sie ist voll vom Graffiti.
Warum malt jemand seinen Namen auf eine Wand?
Bird: Weil du wenigstens einmal, für eine Sekunde realisieren möchtest, dass du am Leben bist. Ob du deinen Namen auf einem Stück Papier schreibst oder an eine Wand ist eigentlich egal.
„London hat eine Menge von Berlin zu lernen.“
Die Bilderbuchkarriere eines Graffitikünstlers würde ja vom eigenen Namen auf der Wand, über immer komplexere Bilder bis ins Museum führen. Ist das bei Musikern ähnlich? Mit der ersten Single stellt man seinen Namen vor…
Bird: Dann wird die Musik komplexer… Eines der ersten Dinge, die ich in dem Sinne getan habe, meine Steinzeit-Wandmalerei sozusagen, war das Aufnehmen von Songs aus dem Radio. Ich habe da mit meinem Kassettenrecorder gesessen und zwischendurch habe ich mich selbst aufgenommen und den Radiomoderator gespielt: „Okay, das war sowieso und jetzt hören wir als nächstes das und das.“ So hat es angefangen.
Wurde Ihnen das eigene Programm irgendwann so langweilig, dass Sie angefangen haben, selbst Musik zu machen?
Bird: Ja, ich habe verschiedene Materialien und Medien ausprobiert, verschiedene Farben und Leinwände, wenn man so will. Ich stelle gerade fest, dass Graffiti in der Tat eine sehr schöne Metapher dafür ist, wie ich meine Musik sehe. Wirf einfach den Mist an die Wand und schau was kleben bleibt. Ich muss das so wohl so machen, anders geht es nicht. Alles was ich will, ist es zu genießen und mich zumindest halbwegs damit zufrieden zu fühlen. Und alles was ich weiß ist, dass ich immer wieder zu lernen und mir neues beizubringen habe. Ansonsten würde ich verrückt.
Was haben Sie denn zuletzt in London gelernt?
Bird: Oh Gott, das war etwas Schreckliches… Das Letzte, was ich dort gelernt habe, war, jemanden aus dem Weg zu gehen, ihn komplett zu ignorieren, selbst wenn er mir auf dem Flur entgegen kommt. Eigentlich will ich gar nicht so jemand sein, aber ich wollte mit diesem Menschen einfach nichts mehr zu tun haben. Es wurde dann eiskalt zwischen uns und ich musste lernen, das auch auszuhalten.
Kommen wir zu Ihrer neuen Platte, „The Architect“. Sie macht es einem Journalisten ziemlich leicht, die erste Frage zu stellen, denn Sie singen: „Wenn jeder ein Kritiker wäre, würde niemand irgend etwas tun.“ Können Sie mit Kritik nicht umgehen?
Bird: Darum geht es mir gar nicht. Jeder Mensch bildet sich doch seine Urteile über andere und das, was sie tun, ob man das nun bewusst macht, oder nicht. Man muss aber eben wissen, was man will und nicht will, um durchs Leben zu kommen. Ich will damit nur sagen: Man darf seinen Instinkt nicht überhören, dein Bauchgefühl ist das einzige Kriterium, das zählen sollte. Die Urteile von anderen können dich lähmen. Und auch ein Hype erzählt dir nur Bullshit.
Also hat Ihr Instinkt Sie auch in die vielen verschiedenen musikalischen Richtungen der neuen Platte gleitet?
Bird: Ja, das war mir aber egal. Es könnte mir kaum weiter am Arsch vorbeigehen. (Lacht) Ich liebe einfach zu viele Arten von Musik. Es gibt zu viel, was ich gerne ausprobiere.
Als Kritiker würde ich jetzt sagen: Da breitet jemand ein Buffet aus, von dem sich jeder nehmen kann, was er will. Das passt auch zu Berlin, wo man ja so gerne brunchen geht.
Bird: Ja, wahrscheinlich. Ein Brunch macht ja auch alle glücklich. Ich bekenne mich schuldig, ich versuche die Menschen glücklich zu machen. (Lacht) Es kann durchaus sein, dass das das einzige ist, was meine Musik richtig beschreibt: Sie ist ein großes Mischmasch-Brunch.
Wie funktioniert das auf der Bühne, im Konzert? Ist das eher anstrengend?
Bird: Kann sein. Auf jeden Fall für einige Leute im Publikum, da bin ich mir sicher (lacht). Aber tatsächlich funktioniert es für mich sehr gut. Ich sage den Leuten immer: Ihr müsst mich überhaupt nicht mögen. Ich werde meine Scheiße nicht so geschmeidig machen, dass ihr sie leichter schlucken könnt. Ich mache einfach das, was ich mache. Ich will nur Dinge ausprobieren. Wenn ich in der Kneipe neben einem Paar sitze, das ich nicht kenne, oder neben einem Mörder, dann halte ich mir ja auch nicht die Ohren zu. Ich will hören, was die zu erzählen haben.
Haben Sie schon mal mit einem Mörder in einer Kneipe gesessen?
Bird: Ja, das ist mir tatsächlich passiert. Er war gerade aus dem Gefängnis gekommen. Er hatte einem anderen mit einem Stuhl den Schädel zertrümmert. Ich fragte: Warum hast du das gemacht? Er sagte: Weil ich es wollte. Dann haben wir noch ein paar Bier getrunken und geredet.
Er wollte diesen Mann umbringen, oder ihm nur mit den Stuhl einen über den Schädel ziehen?
Bird: Er wollte ihn wirklich umbringen. Der Typ hatte mit seiner Frau geschlafen. Wie auch immer, die Gelegenheit war einfach da, sich mit ihm zu unterhalten und ich habe sie genutzt. Es ist vielleicht so, wie wenn ich ein Techno-Stück aufnehme, plötzlich stolpere ich über eine Jazz-Melodie und verbinde das dann einfach, weil es sich richtig anfühlt.
Dieser Vergleich klingt ein bisschen schief. Andererseits hat die Verbindung von Mord und Musik ja eine gewisse Tradition. Johnny Cash sang: „I shot a man in Reno, just to watch him die“. Und es gibt doch diese Platte aus den Achtzigern…
Bird: (Lacht) „Meat Is Murder“ von The Smiths?
Ja richtig. Aber lassen wir das. Was mir an Ihrer neuen Platte sehr gut gefällt, ist unter anderem der Einsatz einer Blockflöte. Die hat ja zu Unrecht einen schlechten Ruf.
Bird: Ja, sie gilt ja als ein Folterinstrument, mit dem Kinder in der Grundschule gequält werden. Genau deshalb habe ich sie ausgesucht (lacht). Außerdem mag ich den Sound solcher klassischen Instrumente sehr. Demnächst wird auch ein Kammermusik-Ensemble aus Dublin einen meiner neuen Songs remixen. Kein Witz.
Wie kam es denn zu den Anklängen an russische Techno-Pop-Elemente im Song „Gloria“?
Bird: Russische Pop-Musik? Interessant. Es ist immer gut zu hören, wie andere Leute meine Musik beschreiben. Ich habe zu ihr einfach keinen Abstand.
Ich meine damit diesen gewissen Neunziger-Jahre-Beat. Den Song könnte man sich gut im Fitness-Studio anhören.
Bird: Ja! Ich gehe zwar nicht in solche Läden, aber das kann schon sein. Als ich in London war, habe ich meinen Arsch nie hoch gekriegt, da habe ich überhaupt keinen Sport gemacht. Ich steckte in einer üblen, langweiligen Beziehung. Ich wurde zur Hausfrau, die nur auf ihren Mann gewartet hat um ihm dann zu sagen: „Endlich bist du da! Ich habe Abendessen gemacht!“ Ich habe ein Jahr lang keinen Song geschrieben, ich war wie ein Zombie.
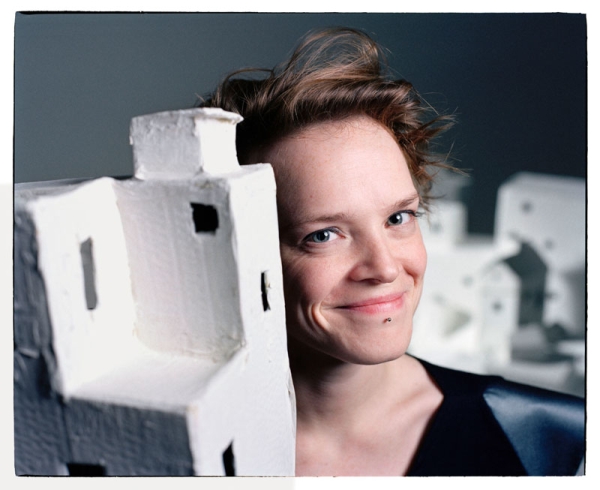
© Jens Oellermann
Die Liebe hat einen Zombie aus Ihnen gemacht?
Bird: Ja, so war das. Ich wurde faul und träge, weil ich verliebt war. Es dauert eine Weile bis man bemerkt, dass man ein Zombie geworden ist. Deswegen bin ich in Berlin auch erstmal nur tanzen gegangen. Und vieles was in diesem Song „Gloria“ erzählt wird, hat damit zu tun, was physisch passiert, wenn ich tanze. Dieses neu gewonnene Körperbewusstsein hat mich verändert, ich sehe jetzt komplett anders aus. Ich spüre Muskeln in meinem Armen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Sich der Körperlichkeit des Tanzens bewusst zu werden, darum geht’s auf meiner neuen Platte. Das klingt als Konzept vielleicht ein bisschen lahm, aber was soll’s? (lacht)
Können Sie Ihren Tanzstil beschreiben? Ändert er sich, je nachdem, ob Sie zum Beispiel im Berghain oder im SO 36 tanzen?
Bird: Ich glaube, ich tanze genauso unterschiedlich, wie sich meine Musik anhört. Manchmal eher wellenförmig. Dann wieder sehr eckig.
Was kann man zu Ihrem Song „The Cards“ tanzen?
Bird: Oh, das ist ein ganz langsamer trauriger Walzer.
Er klingt wie eine Mischung aus The Who zu deren Rockoper-Zeiten und den sphärischen Klängen von Enya.
Bird: (Lacht) Dieser Song war wirklich ein verwirrender Trip. Ich war verliebt und niemand wollte mich. Niemand war bereit, mich mit nach Hause zu nehmen und um mich seinen Eltern vorzustellen.
Das klingt, als wären Sie in viele Menschen zugleich verliebt gewesen. Haben Sie ein weites Herz?
Bird: Nein, es ist ein winzig kleines dreckiges Stück. Ich habe das Herz einer Schildkröte.
Es schlägt langsam und zieht sich schnell zurück?
Bird: Nein, es ist viel zu leicht zu finden, wie eine Meeresschildkröte am Strand. Das ist mein Problem.
Immerhin sind Schildkröten bekannt für ihre hohe Lebenserwartung.
Bird: Wer lange lebt, hat auch viel zu verlieren… Aber danke, dass Sie mich danach gefragt haben, was das für ein Tanz ist. Das freut mich. „The Cards“ ist mein Lieblingssong auf dem neuen Album. Ich habe ihn im Januar 2012 geschrieben, als ich gerade nach Berlin gezogen war. Er ist Song über Konfusion. Über zu viele Veränderungen.
Ist diese Konfusion mittlerweile vorbei?
Bird: Also, was mich persönlich angeht: Bisher rutsche ich immer von einer Beziehung in die nächste. Aber momentan fühlt es sich einfach großartig an, alleine zu sein. Ich merke, dass ich erstmal meinen eigenen Kopf klar kriegen muss, bevor ich mir über jemand anderen Sorgen mache. Das geht so weit, dass ich mich zehn Tage in eine Hütte zurückgezogen habe, nur um zu schreiben. Viele meiner Freunde haben nämlich gerade Erfahrungen mit dieser 10-Tage-Meditation gemacht. Kennen Sie die?
Noch nicht.
Bird: In dieser Zeit spricht man noch nicht mal. Also habe ich das auch so ähnlich probiert, aber ich habe es gehasst, es war schrecklich. Ich brauche Menschen nunmal, unglücklicherweise. Ich bin in der Richtung vielleicht immer noch ein bisschen unreif. Andere Menschen machen mich eben glücklich. Aber zum Glück weiß ich mittlerweile auch, wie man vor Leuten davonläuft. Also gleicht sich das irgendwie aus.
Sie haben ja schon einmal in Deutschland gelebt und an der Popakademie studiert…
Bird: Ja, in Mannheim, drei Jahre lang. An der Schule war ich aber nur drei Monate, im Rahmen eines Stipendiums.
Hatten Sie vorher versucht, sich zum Beispiel an dem Liverpool Institute For Performing Arts zu bewerben, das Paul McCartney gegründet hat?
Bird: Nein, ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht der Typ für so etwas. Auch in der Schule war ich immer entsetzlich schlecht. Die interessierte mich einfach nicht. Das mit dem Stipendium hatte sich einfach ergeben. Ich dachte: Toll, du hast die Möglichkeit, für drei Monate ins Ausland zu gehen und wirst auch noch bezahlt? Klar, mache ich! Ich wollte aber nur Leute kennen lernen und Musik machen.
Haben Sie irgendwas in Mannheim über Pop gelernt?
Bird: Ja, ich habe ein paar wirklich schöne Gitarrenstunden gehabt, mit einem jungen Gitarristen, der hat meinen Stil geändert, meine Art zu spielen. Das war wirklich eine große Sache für mich. Aber an der Akademie habe ich eigentlich nur gelernt, wie man zu einem Lehrer sagt: „Fuck you!“ (lacht)
