Herr Schneider, Sie werden heute 85. Wenn aus diesem Anlass eine Rede gehalten würde, was würden Sie sich wünschen, darin zu hören und was lieber nicht?
Wolf Schneider: (überlegt lange) … Ach Gott! … Auf eine Rede auf einem Geburtstag kann man schlecht antworten, ansonsten bin ich ja für Widerspruch dankbar, weil er meine rhetorischen Talente beflügelt…
Henri Nannen, mit dem Sie fünf Jahre beim „Stern“ zusammengearbeitet haben, hat über Sie gesagt: „Er ist ein Arschloch, aber er ist der einzige, der´s kann.“
Schneider: Was die Journalisten-Schule angeht.
Nur darauf bezogen?
Schneider: Ja. Ich habe ja 1971 den Stern verlassen, und 1978 stand die Frage an: Wer soll eigentlich die Schule führen, die wir auf dem Papier schon gegründet haben? Da sagte Nannen im Vorstand diesen Satz über mich und mit dem kann ich sehr gut leben. Das war überhaupt die Art, wie wir miteinander umgingen: sehr dreist und sehr respektvoll. Wir haben uns im „Stern“ halt immer gehakelt. Er war ein gewaltiger Rhetor. Ich habe ihm heftiger und böser, als er es gewohnt war, widersprochen. Eigentlich machte das auch ihm Spaß. Ich wurde in der Redaktion populär, weil man so viel Widerspruch gegen den Urvater Nannen nicht gewöhnt war, und das – „er ist ein schwieriger Mensch und ich mag ihn vielleicht nicht besonders, aber er hat was auf dem Kasten“ – kam offenbar in diesem Satz zum Ausdruck.
Sie gelten als der „Levitenleser der Nation“, als „Sprachpapst“, „Deutschlands bester Deutschlehrer“. Sind Sie stolz auf diese Titel?
Schneider: Ja, insofern als sich in ihnen ein gewisser Respekt für meine Rolle äußert schon, die Wortwahl ist nicht besonders angenehm. Mit Päpsten habe ich überhaupt nichts am Hut, und „Deutschlehrer“ ist auch nicht ganz richtig. Der Deutschlehrer lehrt korrekte Grammatik. Mein Hauptthema ist, jenen Berufsschreibern, mit denen ich es zu tun habe, nämlich Journalistenschülern und Öffentlichkeitsarbeitern, klar zu machen, was für grauenvolle, unlesbare, langweilige, abstoßende, unverständliche Sätze man mit völlig korrekter Grammatik produzieren kann. Also, ich fange dort an, wo die Deutschlehrer aufhören und wo übrigens auch Bastian Sick aufgehört hat.
Sie sollen sehr streng mit Ihren Schülern sein. Sind Sie auch streng mit sich selbst?
Schneider: Ja, insofern, als ich den von mir mal in der Journalistenschule in Umlauf gesetzten Spruch „Qualität kommt von Qual“ auch auf mich selber anwende. Ich plage mich mit allem, was ich tue. Ich habe mir vor Jahrzehnten abgewöhnt, etwas gut zu finden, bloß weil es von mir ist und schon da steht. Nein, ich schreibe sehr schnell, und dann arbeite ich eisenhart. Ich lasse mir nichts durchgehen. Meine Frau ist meine erste Gegenleserin. Wenn sie über ein Stück sagt, das soll ich nicht abschicken, das ist nicht gut genug von dir, dann bin ich drei Stunden schlechter Laune und dann schreibe ich es neu.
Wie lange schreiben Sie an einem Buch?
Schneider: Das letzte ist im März erschienen („Deutsch für junge Profis“, Anm. d. Red.). Daran habe ich ein dreiviertel Jahr gearbeitet. Das hat ja nur 150 Seiten. Das nächste ist jetzt projektiert im Rowohlt-Verlag, aber darüber rede ich noch nicht. Ich sammle gerade das Material. Das ist die schönste Phase. In der hat man noch die Lust – und nicht die Maloche des Niederschreibens.
Sie haben inzwischen 26 Bücher veröffentlicht. Darunter, neben den Stil-Bibeln für die Sie bekannt sind, auch Sachbücher über den Kölner Dom, die Alpen, Gewinner und Verlierer und das Glück. Was treibt Sie, so viel zu schreiben, über so unterschiedliche Themen?
Schneider: Man sollte Mozart nicht fragen, warum er komponiert hat. Ich bin kein Mozart, aber ich bin ein Schreiber von Geblüt. Es ist etwas, das sich nicht rational begründen lässt. Ich habe ja einige Anerkennung und Erfolge damit. Es ist mein Lebenselixier.
Sie sagen, dass nur ein paar wenige sprachliche Grundsätze zu berücksichtigen sind, um so zu schreiben, dass man gelesen wird…
Schneider: Nein, das ist nicht ganz richtig. Für die Verständlichkeit eines Textes gibt es ein paar eiserne Grundregeln, die kann man an den Fingern einer Hand abzählen. Aber die Verständlichkeit ist nicht alles. Die kulminiert ja vernünftigerweise in der Gebrauchsanleitung für einen Feuerlöscher und die liest sich, wenn es nicht brennt, nicht interessant genug. Man muss also über die Verständlichkeit, die immer dazugehört, wenn man viele Leser haben möchte, hinaus attraktiv sein. Man muss die treffendsten Wörter wählen, die hübschesten Beispiele und Vergleiche, den schönsten Anfang – alle möglichen Elemente, die sich nicht messen lassen, über die sich aber die Stil-Lehrer alle einig sind. Ich habe alle Stil-Lehren gelesen, die in englischer und deutscher Sprache je erschienen sind, dies kombiniert mit meiner sehr ausführlichen Berufserfahrung und dem grandiosen Lehrer Henri Nannen ermutigt mich, auch über das schwerer messbare Element des attraktiven Deutsch, das über die Verständlichkeit hinausgeht, ein paar Faustregeln aufzustellen.
Und deshalb elf Bücher über die deutsche Sprache?
Schneider: Ich war nach drei Büchern eigentlich satt. Aber dann kam der Rowohlt-Verlag und das Buch „Deutsch! Handbuch für attraktive Texte“. Als aber Rowohlt Berlin mich fragte, ob ich „Deutsch für junge Profis“ schreiben wollte, nun noch ein Sprachbuch, habe ich zunächst mal gelacht. Denn erstens: Wie nimmt man dem 85-Jährigen die jungen Profis ab? Dann stellte sich heraus: Ich komme durch meine Seminare so viel mit 20-Jährigen zusammen, wie wenige Leute in Deutschland. Ich weiß also genau, wie die ticken und wo sie der Schuh drückt. Und zweitens, seit Mail, Blog und Twitter, wird heute dreimal so viel geschrieben wie vor 20 Jahren, aber keineswegs dreimal so viel gelesen, sondern halb so viel. Und daraus folgt, da die Ungeduld und die Produktion an Geschriebenem gewachsen ist, war es noch nie so schwer gelesen zu werden. Also sind meine alten Ratschläge so wichtig und aktuell wie noch nie: „Wenn ihr euch als Blogger nicht mindestens so plagt, wie Journalisten das hoffentlich seit Jahrzehnten tun, dann habt ihr überhaupt keine Chance gelesen zu werden.“
Warum haben gerade Sie, der gegen alles Überflüssige im Sprachlichen zu Felde zieht, den zahlreichen Glücks-Büchern ein weiteres hinzugefügt?
Schneider: (lacht) Ja, das war aus aktuellem Ärger. Das Thema „Glück“ interessiert mich seit langem. Ich führe seit 60 Jahren ein großes Privatarchiv und habe immer Stoff für ein halbes Dutzend Sachbücher im Vorrat. Glück interessierte mich. Ich war nun irritiert und belustigt über den ungeheuren Erfolg von Glücks-Ratgebern von Werner Tiki Küstenmacher und anderen. Dann las ich die und war entgeistert über so viel Primitivität und bot Rowohlt an: Jetzt schreibe ich mal ein Anti-Glücks-Buch. Das Madigmachen der allzu primitiven Glücksratgeber ist die Nebensache, der Anlass war, dass ich, wie ich hoffe, ein sehr seriöses Buch über das Glück geschrieben habe.
Ihre Lektoren/innen dürften zu den glücklichsten der Branche gehören, wenn man davon ausgeht, dass Sie all das, was Sie in Ihren sprachkritischen Büchern propagieren, auch in den eigenen anwenden. Werden Ihre Manuskripte so gedruckt, wie Sie sie abgeben oder trauen sich Ihre Lektoren doch auch hin und wieder zu kritisieren und zu korrigieren?
Schneider: Natürlich trauen sie sich. Aber ich habe erfreulicherweise das überwiegende Echo, dass meine Bücher ihnen weniger Arbeit machen, als die anderer Autoren, weil ich eben sehr diszipliniert schreibe und sehr hart gearbeitet habe, ehe ich abliefere. Ich habe jedes Buch, ehe es den Lektor erreicht, kapitelweise mindestens dreimal laut gelesen. Das ist der beste Test, ob es sich auch stumm richtig lesen würde. Einwände oder vernünftige Ergänzungsratschläge haben Lektoren immer. Bei einem Drittel dieser Einwände fühle ich mich vielleicht ertappt und denke: Mensch, das hätte dir auch einfallen können, bei einem weiteren Drittel denke ich: Mir ist es Wurscht, aber wenn es der Lektor will, dann mache ich es eben. Und bei einem Drittel sage ich: Nee, das mache ich nicht, und dann sind sie auch zufrieden.
Ich fange dort an, wo Bastian Sick aufhört.
Von 1979 bis 1995 waren Sie Leiter der Hamburger Journalistenschule. Haben Sie während dieser Zeit Veränderungen im Sprach- und Schreibstil Ihrer Schüler beobachtet?
Schneider: Ja, und nicht nur dann. Ich bin ja weiter an Journalisten-Schulen tätig. Ich kann also seit 31 Jahren überblicken, was mit der deutschen Sprache geschieht. Eindeutig ist, die Kenntnis der Grammatik lässt nach, zum Beispiel die Benutzung korrekter Konjunktive, die korrekte Zeichensetzung lässt nach, und die neue Rechtschreibung produziert genauso viele Fehler wie die alte. Außerdem gibt es eine gewisse Verarmung des Deutschen, indem nämlich auch Journalisten Unterscheidungen nicht mehr vornehmen. So liest man zum Beispiel häufig schon in der Zeitung das Wort „wähnen“ als Synonym für das Wort „glauben“. Ich finde das schrecklich. „Wähnen“ heißt ja „fälschlich glauben“, „sich einer Wahnvorstellung hingeben“. Die Passagiere der Titanic wähnten sich in Sicherheit – was für ein schönes, kraftvolles Wort. Stattdessen liest man es einfach als Austauschwort für „glauben“. Man hört Unterschiede nicht mehr, man bedient sich törichter Modeworte wie Aktivitäten. Mit Marketing wäre eigentlich alles gesagt, aber man schreibt lieber „Marketing-Aktivitäten“.
Beeinflussen Computer und Internet unsere Sprache?
Schneider: Sehr lebhaft. Einerseits schon im Schreiben, weil eine große Sorglosigkeit um sich gegriffen hat. Der typische Mail-Absender produziert ja dreimal so viel wie früher. Es ist auch gar nicht üblich, dass er eine Kontrolllektüre vornimmt. Häufig wird die Großschreibung unterlassen, Grammatik ist auch nicht so wichtig. Die Texte der Mails sind also drastisch lockerer, weniger korrekt und geschwätziger. Das Ganze bei den Blogs erst recht. Natürlich gibt es hochinteressante und sehr wichtige. Aber das meiste, was bei einem Zufallsgriff in den Computer herauskommt, ist ein merkwürdiges, vollkommen hemmungsloses und entbehrliches Wortprodukt.
Vor einem Jahr sind auch Sie unter die Blogger gegangen. In Ihrem monatlichen Video-Blog auf sueddeutsche.de („Speak Schneider“, Anm. d. Red.) reden Sie Professoren, Deutschlehrern und Feministinnen ins Sprachgewissen. Haben Sie das Internet für sich entdeckt?
Schneider: Nein, ich habe auch diesen Blog nicht für mich entdeckt, sondern Journalisten-Schüler aus Hamburg vom vorletzten Lehrgang haben die Initiative ergriffen. Die kommen so alle paar Monate mit einem Kamerateam und nehmen die nächsten drei, vier Stücke auf. Ich war freudig bewegt, dass junge Leute meinen: Der alte Knacker hat noch was zu sagen. Das ist meine einzige Internetaktivität.
Es heißt Sie benutzen keinen Computer, schreiben alles mit der Hand…
Schneider: Das ist richtig. Ich habe mal Stenografie erlernt, die offizielle, und sie durch eine private Stenografie für besonders wichtige Wörter zum jeweiligen Thema ergänzt, und dadurch schreibe ich viel schneller als damals jede Stenotypistin und heute als jeder Texteingeber. Computer gehen ja nicht viel schneller als die elektrische Schreibmaschine. Das dauert mir zu lange. Dazu kommt, dass ich als typischer Sachbuchautor gerne fünf, sechs, sieben Bücher gleichzeitig auf dem Tisch habe, wo passt da ein Computer hin? Ich hätte es lernen müssen, wenn sich nicht meine Frau, als wir nach Mallorca zogen und ich keine Sekretärin mehr hatte, mit Begeisterung auf den Computer geschmissen hätte. Sie sitzt drei, vier, fünf, sechs Stunden täglich davor und beherrscht alles…
… und schreibt Ihre Texte in den Computer…
Schneider: Erstens schreibt sie meine Texte, da sie meine Stenografie als einziger anderer Mensch auf der Welt auch noch lesen kann, aber das ist nur die mechanische Arbeit. Sie macht alle Recherchen, die ich brauche, und das sind sehr viele für meine Sachbücher, und sie polstert mich ab gegen die elektronische Welt. Ich kriege zu meinen Sprachbüchern manchmal ein Dutzend sehr spezielle Anfragen oder Vorschläge pro Woche: Finden Sie nicht, dass der NDR das Wort „sozusagen“ ein bisschen zu häufig verwendet? Solche Mails beantwortet meine Frau immer sehr nett.
Der typische Computernutzer, wie meine Frau ja auch, verbringt mindestens sechs Stunden am Tag vor dem Dings da, wie soll ich da noch ein Buch schreiben? Es ist eine Abwehr, die durch eine, Gott sei Dank, in späten Jahren ungewöhnlich glückliche Ehe aufs Schönste funktioniert.
Sie haben 9 Jahre lang die NDR-Talkshow moderiert. Was ist schwieriger: zu moderieren oder zu schreiben?
Schneider: Hm, moderieren ist kurzweiliger. Man muss sich zwar ein bisschen vorbereiten. Ich habe mich immer sehr gründlich vorbereitet, damit man gescheite Fragen stellen konnte. Am schönsten war eine israelische Sängerin, über die es überhaupt nichts schriftlich gab, da musste man halt improvisieren. Das machte gar keine Arbeit. Aber wenn der Präsident des Bundeskartellamts kam, musste man natürlich sehr viel gelesen haben, um zu wissen, ob es überhaupt eine populäre Frage gibt, die man stellen könnte. Die Sache selber war ja ein Vergnügen. Also Bücher machen viel (gedehnt) mehr Arbeit. Bücher sind eben nicht nur Spaß. Damit man sie durchhält, sind sie Maloche. Man kann nicht in jedem Stadium des Schreibens glücklich sein. Das gibt’s nicht.
Sie unterrichten immer noch in fünf Journalistenschulen, halten Seminare für Manager und Öffentlichkeitsarbeiter. Langweilt es Sie nach über 30 Jahren als Sprachlehrer nicht, immer wieder die gleichen Dinge zu erzählen?
Schneider: Nein, im Gegenteil, es ist richtig spannend. Schon von daher, weil ich auf immer neues Material stoße. Vor jedem Seminar lasse ich mir von sämtlichen Teilnehmern jeweils ein Dutzend Texte schicken. Und diese ein-, zweihundert Seiten habe ich vorher durchgearbeitet und beginne sie nun zu ertappen, sie festzunageln und ihnen alles unter die Nase zu reiben, was sie an Sünden gegen die Verständlichkeit oder an Süden gegen die Attraktivität begangen haben.
Das macht Ihnen Spaß.
Schneider: Tja, mein Gott. Dem Tischler macht es ja hoffentlich Spaß, einen Tisch zu machen. Und mir macht es Spaß, dass ich meinen Erfahrungsvorsprung in halbwegs launiger Form an Leute, die das hören wollen, weitergeben kann.
Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Auf was sind Sie besonders stolz?
Schneider: Hm, hm. (überlegt) Ich habe vier Kinder groß gezogen. Die sind ganz wohl geraten. Stolz bin ich auf meine 26 Bücher – vor allem aber auf diese drei: „Wörter machen Leute – Macht und Magie der Sprache“, schon 17mal neu aufgelegt und seit nunmehr 34 Jahren im Handel. Meine Weltgeschichte des Ruhms: „Die Sieger“. Und meinen Roman der Menschheit: „Der Mensch – eine Karriere“, der Neuen Zürcher Zeitung zufolge „ein grandioses, mit gewaltigem Wissen geschriebenes historisches Panorama“. Ich habe 330 Journalistenschüler hauptberuflich und mehr als 1000 insgesamt ausgebildet. Ich habe auf 27 4000ern der Alpen gestanden, was mir nicht in die Wiege gelegt war. Ich bin kein großer Sportler. Tja, mein Gott, stolz ist nicht das Wort, das mir einfällt. Sondern ich habe den Eindruck: Alles in allem hat mich der liebe Gott auf der Sonnenseite des Lebens angesiedelt, und ich habe immer was draus gemacht.
Konnten Sie Ihre Sprachbegeisterung an Ihre Kinder weitergeben oder hat sie Ihre Unerbittlichkeit in sprachlichen Dingen abgeschreckt?
Schneider: Nein, gar nicht. Zwei von ihnen sind Journalisten. Meine älteste Enkelin auch. Umgekehrt. Meine Tochter, Textchefin des SZ-Magazins, ist eine besonders findige Gegenleserin. Schwierige Texte, bei denen ich mir nicht sicher bin und bei denen auch meine Frau sich nicht sicher ist, gehen auch noch an sie als Gegenleserin weiter. Sie ist imstande, mich mit einem einzigen Satz zu einem völlig neuen Kapitel zu verdonnern.
Was möchten Sie in Ihrem Leben noch erreichen?
Schneider: Die große Leidenschaft für das Bergsteigen kann nicht mehr stattfinden. Die Knie sind kaputt. Das ist Alters-Arthrose, man nennt es auch etwas freundlicher Bergsteiger-Knie. Bergsteigen ist ja ungesund, wie jeder Sport. Man macht sich bei den langen Abstiegen die Knie kaputt. Ich kann nur noch „schreiten“, was ich mein Leben lang gehasst habe. Tja, ich hoffe, dass ich noch mal ein gutes Buch unterbringe und dass ich noch viele schöne Reisen machen kann. Sich besonders große Ziele zu stecken, ist wohl nicht mehr realistisch und würde mir auch nicht einfallen. Ich will ja nicht Bundeskanzler werden…
Wann wird das Buch erscheinen, an dem Sie gerade arbeiten?
Schneider: Da habe ich den Vertrag noch nicht. Ich habe gesagt, anderthalb Jahre nach dem Vertragsabschluss. Also in zwei, zweieinhalb Jahren. Der Verlag muss sich ja auch überlegen, wie lange er mir noch Vorschuss zahlt. Die Hälfte aller Leute, von deren Tod ich in der Zeitung lese, ist jünger als ich. Wollen Sie das Rezept wissen für meine Frische? Erstens: gute Gene. Zweitens: fröhlich arbeiten, fröhlich essen, fröhlich trinken und nicht zum Arzt gehen.
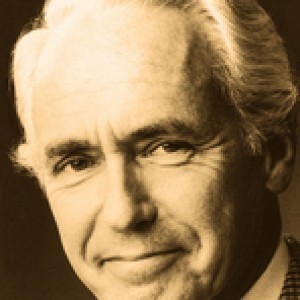
schneider weiß bescheider
jeden morgen druckt frau schneider
tweets und blogeinträge aus
die liest dann ihr wolf, doch leider
kommt dem sprachpapst da der graus
relevanz ist wohl ein fremdwort
blogger, ihr seid alles schwätzer
sprichts und wirft vor wut sein hemd fort
wehe dem grammatikketzer!
ihr wärt gerne selbstdarsteller
die sich für unfehlbar halten?
tut mir leid. auf diesem teller
sitz schon ich beim haarespalten